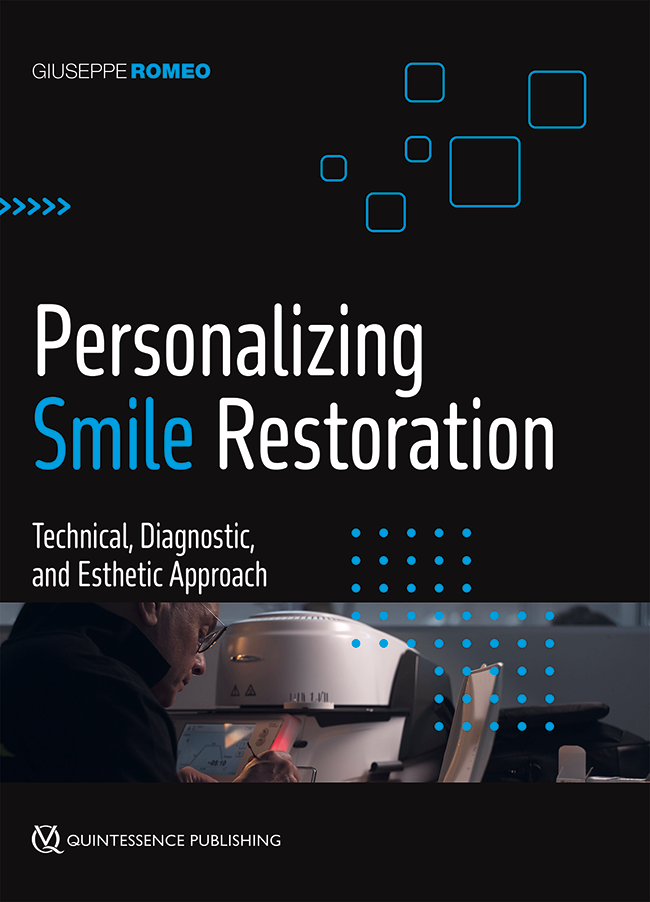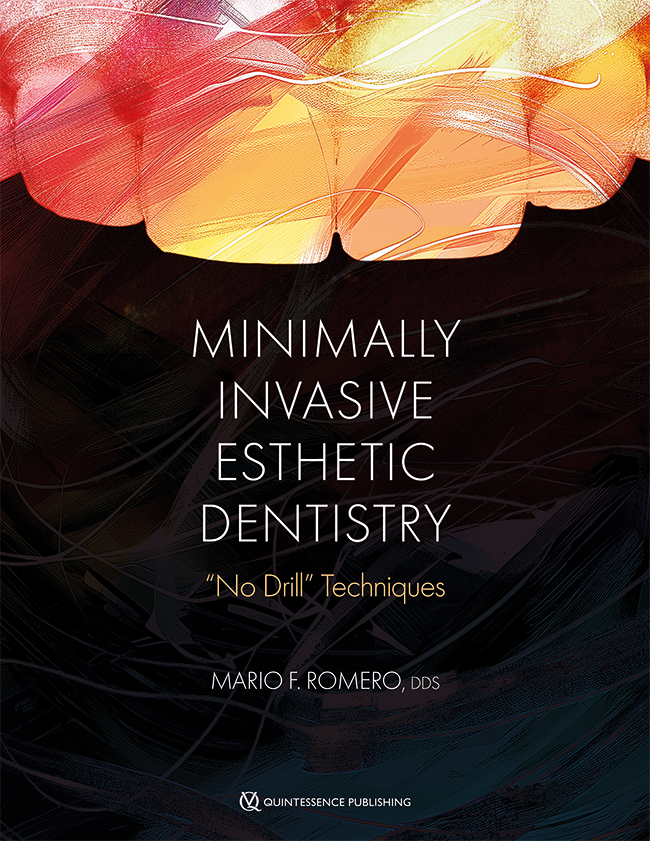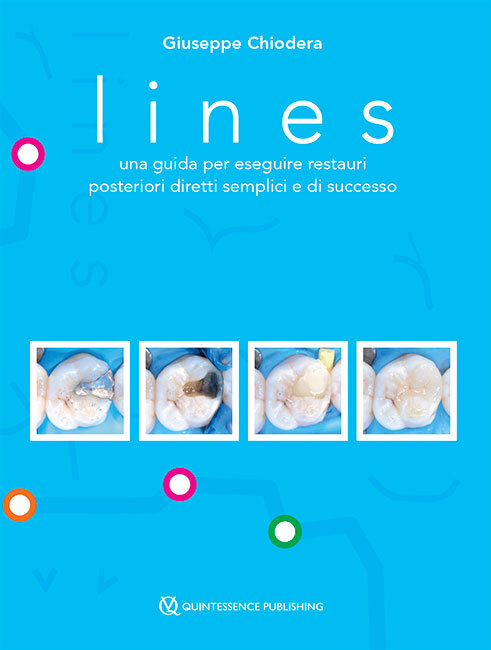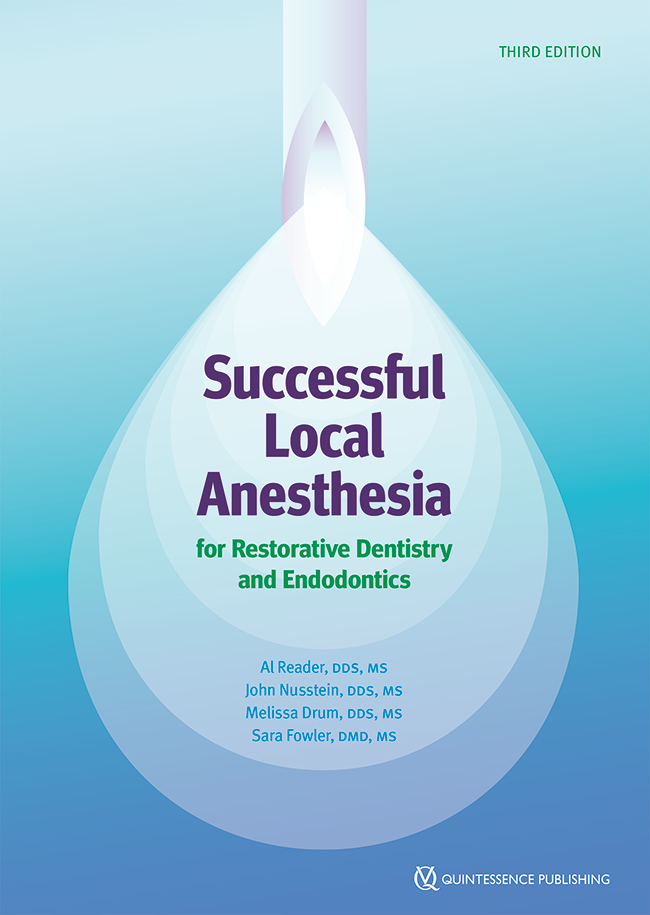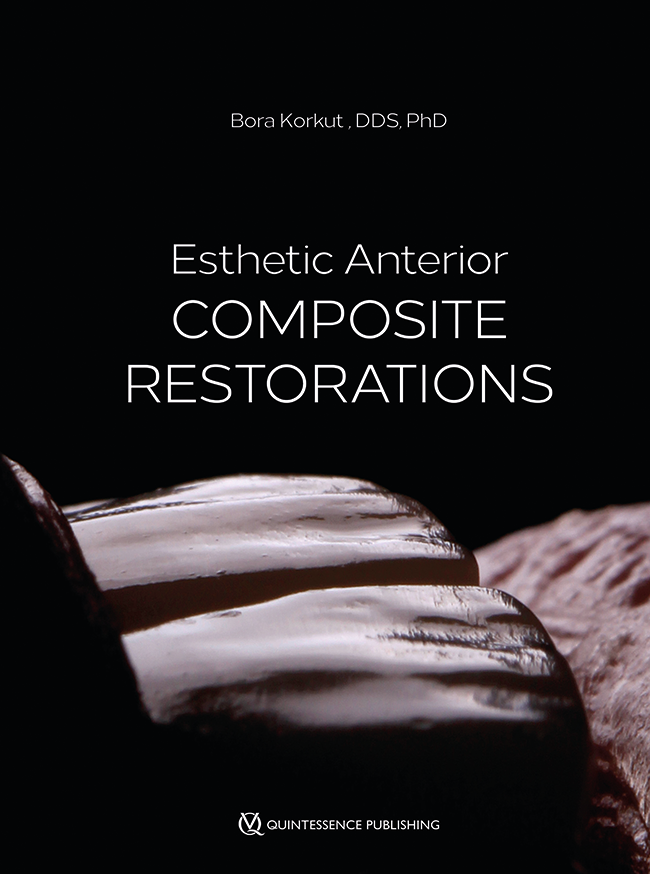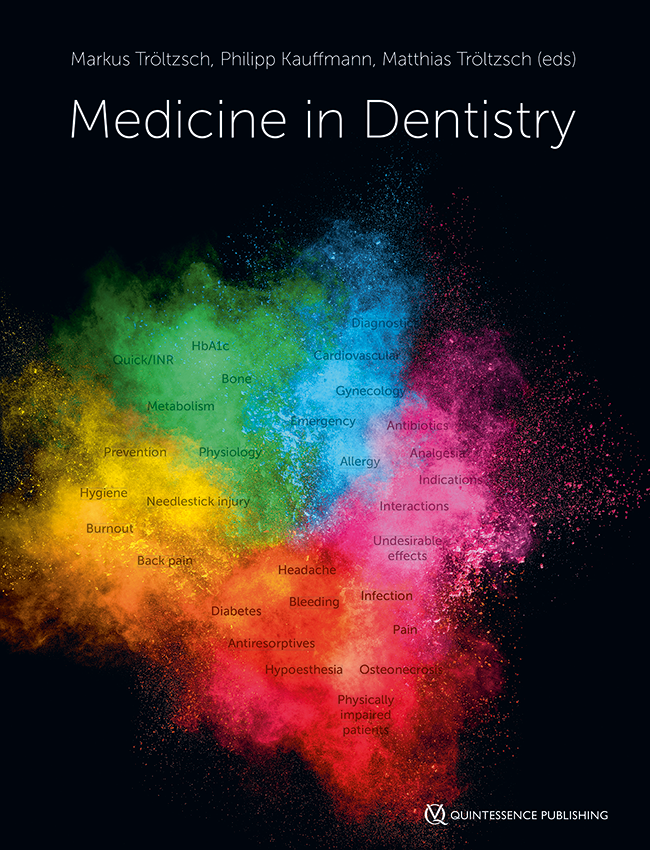Ein weiteres Mal war der Quintessenz Verlag in Berlin Gastgeber einer Ausgabe des „Experten Hearings“, eines exklusiven Formats, das praxisnahe Orientierung zu verschiedenen zahnmedizinischen Themen bietet. Dabei diskutieren in einer eintägigen Veranstaltung ausgewählte Dentalexpertinnen und -experten aus Wissenschaft und Praxis ein Schwerpunktthema unter unterschiedlichen Gesichtspunkten.

Unter dem Titel „Effizient. Innovativ. Durchdacht. Der Workflow der Zukunft. Direkte Restaurationen am Zahn der Zeit“ lud das Dentalunternehmen Ivoclar, weltweit führender Anbieter von Systemlösungen für die moderne Zahnheilkunde mit Hauptsitz in Liechtenstein, im Mai sechs Expertinnen und Experten zur Diskussion ins Berliner Verlagshaus ein.
Unter der fachkundigen Moderation von Prof. Dr. Rainer Haak (Leipzig) beleuchteten das Thema: Prof. Dr. Cornelia Frese (Heidelberg), Dr. Stephanie Huth (Klingenberg am Main), Dr. Firas Chakroun (Wiesendangen, Schweiz) und Dr. Carola Pentelscu, Senior Research Associate Research Clinial, Ivoclar, sowie Anja Stouten, Head of Mature Markets Direct Restoratives bei Ivoclar, und Dr. Philipp Bielec, bei Ivoclar als Teamleiter verantwortlich für die Entwicklung von Komposit-Materialien. Die fachredaktionelle Begleitung übernahm Zahnärztin und Fachjournalistin Dr. Aneta Pecanov-Schröder aus Bonn.

Foto: Fabian Pietsch/Quintessenz
Ergänzend vertieften die Fachleute des Experten Hearings einzelne Aspekte der Diskussion in kurzen Zweiergesprächen vor laufender Kamera. Die Videomitschnitte stellt der Verlag online in Kürze auf der Partner-Seite des Experten Hearings zur Verfügung.
Innovation ist mehr als neue Materialien oder Technologien
Innovation in der Zahnmedizin ist weit mehr als die Einführung neuer Materialien oder Technologien – es geht um Akzeptanz, Integration und das Zusammenspiel aller Beteiligten. Mit dieser Grundhaltung eröffnete der Moderator Prof. Haak den Workshop und gab erste Impulse für den Tag.
„Aus Sicht eines Unternehmens stellt sich dabei eine zentrale Frage: Wie bringen wir unsere technologischen und konzeptionellen Entwicklungen tatsächlich in die Hände der Anwenderinnen und Anwender?“, merkte der Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie an der Universität Leipzig an und ergänzte: „Oder anders gesagt: Wie lassen sich Innovationsprozesse so gestalten, dass sie im Praxisalltag ankommen und wirken?“
„Early Adopters“ sind wichtig
Ein Blick auf die Technology Adoption Curve (Innovationskurve) machte deutlich: Innovation erfolgt nicht gleichzeitig für alle. „Besonders relevant sind die sogenannten Early Adopters, rund 13,5 Prozent der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer“, veranschaulichte der Moderator. Sie gelten als Meinungsführer, beobachten neue Entwicklungen kritisch und prägen damit maßgeblich die Akzeptanz innerhalb eines Markts.
Doch was erwarten diese Early Adopters in der Zahnmedizin? Eine einheitliche Antwort gibt es nicht, zu vielfältig ist die Branche. Umso wichtiger ist es, gezielt für diese Gruppe zu denken und Veränderung so zu gestalten, dass sie praktikabel, nachvollziehbar und anwendungsfreundlich ist. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung des neuen Universalkomposits Tetric plus von Ivoclar. Das Unternehmen hebt die vereinfachte Farbwahl mit vier Farben hervor, eine Schichtstärke von bis zu vier Millimetern für zeiteffizientes Arbeiten, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in allen vier Quadranten und eine optimierte Vier-Füllertechnologie für anwenderfreundliches Handling und ästhetische Ergebnisse.
Was heute als neue Materialgeneration wahrgenommen wird, begann bereits 2016 als Weiterentwicklung bestehender Konzepte. Diese Innovation unterstreicht: Zukunft entsteht durch kluges Vorausdenken, lange Entwicklungszyklen und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Anpassung.
Strukturierter Blick auf den Innovationsprozess
„Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurden zentrale Themenfelder identifiziert, die als Leitplanken durch die Expertenrunde führen“, erklärt Prof. Haak. Sie alle eint die Frage: Wann wird eine Innovation zur echten Verbesserung in der Praxis? – und die Antwort liegt oft im Handling und Workflow. Denn genau dort zeigt sich, ob ein neues Produkt oder Konzept im Alltag überzeugt.
Die Diskussion orientierte sich daher an drei klar umrissenen Themenfeldern:
1. Handhabung und Verarbeitung: Wie lassen sich Materialien intuitiv und effizient einsetzen?
2. Qualitätsorientierung und Qualitätssicherung: Wie sichern wir dauerhaft klinischen Erfolg?
3. Wissenstransfer und Zukunftsperspektive: Wie sieht der aktuelle und zukünftige Workflow aus – und wie bringen wir Innovation dorthin, wo sie gebraucht wird?
Vereinfachung als gemeinsamer Nenner
Welche Aspekte sind mir im Workflow besonders wichtig? Welche Entwicklungen wünsche ich mir für die Zukunft? Mit diesen beiden Leitfragen startete die Diskussionsrunde. Die Teilnehmenden hielten ihre Gedanken zunächst in Form eines Brainwritings auf Karten fest. Nach einer gemeinsamen Sortierung der Beiträge zeigte sich rasch ein klares Bild: Im Zentrum der restaurativen Zahnmedizin steht vor allem eines: die Vereinfachung. Dieser Wunsch nach mehr Klarheit, Effizienz und Praxisnähe zog sich wie ein roter Faden durch die Diskussion und bestimmte maßgeblich die weiteren Gespräche.
Im Alltag zählt der Workflow
Was im Alltag zählt: der Workflow. Die Rückmeldungen zeigten klar, dass im Praxisalltag Materialien und Verfahren schnell, sicher und reproduzierbar funktionieren müssen. Besonders wichtig sind:
- Weniger Arbeitsschritte und ein klar strukturierter Ablauf
- Gutes Handling – vom Bonding über die Modellierbarkeit bis zur Politur
- Geringe Techniksensibilität, zum Beispiel bei Isolation oder Belichtung
- Effizientes Arbeiten durch kurze Aushärtungszeiten und vereinfachte Applikationskonzepte
- Blasenfreie Applikation, stabiles Farbergebnis und einfache Reparaturmöglichkeiten
- Kompatibilität und Vorhersehbarkeit – vom Adhäsiv bis zur finalen Farbe
Die Idealvorstellung? Ein Material, das einfach in der Anwendung, sicher in der Verarbeitung und flexibel in der Indikation ist, auch für das gesamte Praxisteam.
Blick nach vorn: Wünsche für die Zukunft
Auch mit Blick auf zukünftige Entwicklungen blieb der Wunsch nach Vereinfachung und Effizienz bestimmend. Die Runde wünschte sich:
- Stärkere Vereinheitlichung – zum Beispiel einheitliche Aushärtungszeiten für alle Komposite.
- Größere Schichtstärken (wenn vier Millimeter funktionieren, warum nicht auch fünf oder sechs Millimeter?)
- Weniger Endos, mehr Erhalt natürlicher Zähne
- Zuverlässigere Reparaturen und mehr direkte Restaurationen
- Kompatible Systeme – auch im Hinblick auf neue Indikationen wie Stifte oder Befestigung
- Erleichterungen im Praxisalltag: von vereinfachten Matrizensystemen über reproduzierbare Trockenlegung bis hin zur Unterstützung bei QM und MDR
- Materialien, die Arbeitsschritte zusammenfassen, zum Beispiel selbstadhäsive Komposite.
Die ästhetische Vereinfachung war ebenfalls Thema, etwa bei der Frontzahnrestauration mit weniger Farbkomplexität, aber hoher Vorhersagbarkeit.
Fortschritt liegt oft im „weniger“
Die Diskussion zeigte eindrücklich, dass Fortschritt nicht zwangsläufig „mehr“ bedeutet – sondern oft „weniger“: weniger Komplexität, weniger Fehlerquellen, weniger Aufwand. Vereinfachung, verstanden als intelligente Reduktion bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität, ist der Maßstab für Innovation in der restaurativen Zahnmedizin.
Themenfeld 1: Handhabung und Verarbeitung
Dr. Carola Pentelescu, Zahnärztin und Research Associate innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Ivoclar, gewährte Einblicke in den Produktentwicklungsprozess, von In-vitro-Tests über interne Validierungen bis hin zu klinischen Studien. Ziel ist stets, aus Anwendersicht mitzudenken und gezieltes Feedback zu geben. Erst wenn intern alles passt, folgen externe Prüfungen. Ihr persönlicher Weg mit der Tetric-Familie begann 2017 mit Tetric EvoCeram – damals für sie noch zu steif. Tetric Prime überzeugte die Zahnärztin als geschmeidigere Variante: „Mein Herz-Komposite.“
In der Studie zu Tetric PowerFill/PowerFlow begeisterte sie die effiziente Zweischicht-Technik und die Drei-Sekunden-Polymerisation, ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung im Praxisalltag.
Tetric plus vereint für Dr. Pentelescu alle Vorteile: „Keine völlig neue Klasse, aber funktional eine neue Generation – Universal, Bulk, drei Sekunden. Ich kann damit fast alles abdecken – für mich der perfekte Allrounder.“
Farbauswahl überzeugt
Die in Klingenberg am Main niedergelassene Zahnärztin Dr. Stephanie Huth beschrieb ihren Weg mit Tetric EvoCeram als lernintensiv, denn die feste Konsistenz war anfangs ungewohnt, wurde aber mit der Zeit geschätzt. Die Bulk-Materialien kamen ihr entgegen und „Tetric plus entspricht nun nahezu ideal meinen Anforderungen“, brachte es Dr. Huth auf den Punkt.
Besonders lobte sie die überarbeitete Farbauswahl mit klassischen Vita-Farben, „vor allem, weil nun auch dunklere Nuancen verfügbar sind, die ich bei Tetric PowerFill vermisst habe“. In ihrer Praxis dokumentiert das Team die Zahnfarbe in der Patientenakte und wählt vor. „In etwa 80 Prozent der Fälle passt das bereits sehr gut.“ Für die Zukunft wünscht sie sich optionale Effektmassen für den Frontzahnbereich, um das universelle Konzept ästhetisch zu erweitern. Ihr Fazit: „Tetric plus vereint alles, was ich brauche – für mich ist es die eierlegende Wollmilchsau unter den Kompositen.“
Perfekt auch für Seitenzahnfüllungen
Dr. Firas Chakroun, Inhaber der Praxis „Zahnärzte Wiesendangen“ in der Schweiz, sieht Tetric plus als „gelungene Zusammenfassung der vergangenen Jahre“ und als gelungenes Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der Vertrauen in die BulkFill-Technologie geschaffen hat. Besonders lobte er die gute Handhabung bei Seitenzahnrestaurationen. „Anfangs war es mir fast zu klebrig“, merkt Dr. Chakroun an, „aber inzwischen liegt es gut in der Hand und erfüllt meine Erwartungen. Besonders bei Seitenzahnfüllungen ist es für mich perfekt.“ Ein Wunsch bleibt: eine opakere Frontzahnfarbe, etwa im Stil von „A2 Dentin. Dann könnte ich auf IPS Empress Direct verzichten und hätte mit Tetric plus alles, was ich brauche.“
Tetric plus – neuer Standard mit Potenzial für die Lehre?
Aus universitärer Sicht blickte Prof. Dr. Cornelia Frese, stellvertretende Ärztliche Direktorin der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde am Universitätsklinikum Heidelberg und Leiterin der Sektion Präventive und Restaurative Zahnheilkunde, auf eine lange Erfahrung mit der Tetric-Reihe zurück. Schon im Studium arbeitete sie mit Tetric Ceram und Syntac Classic, „damals ein aufwändiger, aber etablierter Goldstandard“, führt die Zahnmedizinerin aus. Mit der Einführung von Tetric EvoCeram und seiner festeren Konsistenz fand man breite Akzeptanz, insbesondere bei der „Amalgam-Generation“. Fast zwei Jahrzehnte war es ein Standardmaterial in der studentischen Ausbildung, trotz Schwächen in der Politurbeständigkeit. „IPS Empress Direct zeigte hier bessere Ergebnisse mit langanhaltendem Hochglanz.“
Nicht jedes Material eignet sich für die Lehre
Beim Thema BulkFill war man an der Universität zunächst zurückhaltend, erläuterte Prof. Frese. In der Lehre gehe es um präzises, schrittweises Arbeiten, weniger um Geschwindigkeit. Für Anfänger sei Tetric PowerFill daher nicht geeignet; die Risiken bei Polymerisation und Lichtführung seien zu groß. Als Backup könne die Drei-Sekunden-Polymerisation jedoch hilfreich sein, etwa bei Behandlungen in Vollnarkose. Mit Tetric plus sieht Prof. Frese nun ein universell einsetzbares Material, das sich auch für die Lehre eignet: gut modellierbar, gut polierbar, mit hoher Anwendungssicherheit – selbst bei drei Millimetern Schichtstärke.
Bei inhomogener Zahnfarbe hochästhetische Komposite besser
Einschränkungen gibt es zum Beispiel bei inhomogener Zahnfarbe. Prof. Frese: „Hier bleiben hochästhetische Kompositsysteme wie beispielsweise IPS Empress Direct die erste Wahl.“ Sie ergänzte einen wichtigen Hinweis: „Vor der Aushärtung zeigt Tetric plus eine gelbliche Farbe, die sich erst nach der Polymerisation an den Farbschlüssel angleicht. Wird das nicht kommuniziert, kann das zu Verunsicherung führen, ein Aspekt, auf den Studierende vorbereitet sein sollten.“
Lernkurve und Farbumschlag – Aufklärung erforderlich
Dr. Philipp Bielec, als Chemiker und Teamleiter des Bereichs Komposite im Hause Ivoclar, maßgeblich an der Entwicklung innovativer Dentalmaterialien beteiligt, erklärte, wie es zu diesem Farbton und dem Farbumschlag durch Polymerisation kommt: „Der gelbe Farbton stammt vom Photoinitiator Ivocerin, der für die Drei-Sekunden-Aushärtung verantwortlich ist. Durch seine hohe Lichtabsorption erscheint es gelb, verschwindet aber vollständig bei der Polymerisation: Der Farbumschlag ist ein geplanter Effekt.“ Dr. Pentelescu sieht darin sogar einen Vorteil, denn „Überschüsse lassen sich vor der Aushärtung besonders gut erkennen.“
Fazit aller Beteiligten: Tetric plus vereint innovative Eigenschaften in einem Produkt, die bislang als widersprüchlich galten. Wie bei jeder Produktneuheit erfordert auch Tetric plus eine kurze Einarbeitungszeit sowie Aufklärung über seine spezifischen Eigenschaften. Eine sorgfältige Planung bleibt dabei, wie schon bisher, entscheidend für ein optimales Ergebnis. „Die Farbwahl muss vor der Applikation erfolgen, da ein nachträgliches Justieren aufgrund der Austrocknung der Zähne wie gewohnt schwierig ist“, erklärt Dr. Pentelescu. „Man muss der initialen Farbwahl vertrauen.“
Adaptation, Viskosität und klinische Präferenz
In der Expertenrunde zeigte sich klar: Die individuelle Anpassung des Handlings durch Kombination unterschiedlicher Konsistenzen gewinnt an Bedeutung. Flowables und Fill-Materialien werden je nach Indikation gezielt eingesetzt:
Im Praxisalltag nutzt Dr. Firas Chakroun vorwiegend das Fill-Material, Flow setzt er gezielt ein – etwa nach endodontischen Behandlungen oder bei kleinen Klasse-V-Kavitäten. Seine Kolleginnen und Kollegen arbeiten häufiger mit Flow, etwa als Liner bei Klasse III- und V-Füllungen. Vorteile seien die gute Randadaptation, besonders an Matrizen, und die einfache Überschussentfernung.
Unterschiedliche Präferenzen bei Flowables
Prof. Dr. Cornelia Frese bestätigte: „In der universitären Ausbildung wird Flow gezielt eingesetzt, etwa an der Schnittstelle zwischen Matrize und Zahn, um glatte Übergänge zu schaffen.“ Zurückhaltend zeigte sie sich bei Klasse III, obwohl der Einsatz hier zunehmend diskutiert wird.
Einen zunehmenden Trend, ausschließlich mit Flowables zu arbeiten – befeuert durch die populäre Flowable Injection Technique, beobachtet Dr. Carola Pentelescu. Die Flowable Injection Technique werde unter anderem auch für funktionelle Anwendungen wie Bisshebungen diskutiert, etwa bei Patienten mit Bruxismus, so Dr. Chakroun. Erste Studien zeigen dabei initial positive Ergebnisse, wobei Resultate zur Langzeitbewährung noch ausstehen.
Zugleich mahnte Prof. Frese zur Vorsicht: Flowables, so praktisch sie erscheinen mögen, „benötigen in bestimmten Indikationen nach wie vor eine Deckschicht – etwa zur Sicherung der Abrasionsstabilität in kaulasttragenden Bereichen.“ Auch regulatorisch werde die Indikationsbreite der Flowables zusehends erweitert: „Bei Ivoclar sind sie für alle nicht-kaulasttragenden Bereiche freigegeben, während andere Hersteller diese Freigabe noch ausdehnen“, so Dr. Pentelescu. Vorteile wie Reparaturfreundlichkeit, Rissresistenz und Materialflexibilität sprechen für den breiten Einsatz.
Entwicklung und Innovation – ein Flow für alle?
Anja Stouten betonte, dass bei der Entwicklung von Tetric plus Flow die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender im Mittelpunkt standen, nicht nur technische Vorgaben. In ihrer Position als Head of Department Mature Markets for Direct Restoratives bei Ivoclar verantwortet sie gemeinsam mit ihrem Team die Produktstrategie für direkte Restaurationsmaterialien in den Märkten Nordamerika, Europa und Australien/Neuseeland. „Während in Deutschland High-Viscosity gefragt ist, bevorzugt man in den USA Low-Viscosity.“ Eine zentrale Frage war lange Zeit: Braucht es mehrere Viskositäten?
Unterschiedliche Wünsche in den verschiedenen Ländern
Ivoclar entschied sich nach internationalen Anwenderstudien bewusst für eine universelle Flow-Viskosität beziehungsweise ein „Flowable, das sowohl für präzise Applikationen als auch für schnellen Volumenersatz – selbstnivellierend – geeignet ist“. Das Material passt sich dem Handling an. „Die besondere Fließeigenschaft von Tetric plus Flow ist auf den Nano-Ytteriumfluorid zurückzuführen“, erläutert Dr. Philipp Bielec. „Dieses ermöglicht gezielte Thixotropie – das Material bleibt in Ruhe standfest und wird unter Druck fließfähig. So lässt sich je nach Applikation die Standfestigkeit des Materials einstellen.“
Einfachheit trifft Individualisierung – ein Balanceakt in der restaurativen Zahnmedizin
„Diese Eigenschaften müssen gut kommuniziert werden, da sie das Handling direkt beeinflussen“, betonte Prof. Haak und Prof. Frese ergänzte, dass auch die Applikationstechnik, etwa durch verschiedene Kanülengrößen, das Handling gezielt steuern kann. Ein zentrales Spannungsfeld in der restaurativen Zahnmedizin wird immer wieder deutlich: Der Wunsch nach einfachen, universell einsetzbaren Materialien steht im Kontrast zu individuellen Präferenzen und Arbeitsweisen, die den klinischen Alltag mitunter komplex gestalten.
Wie Anja Stouten beobachtet, ist diese Anwendervarianz in der Zahnmedizin besonders ausgeprägt – eine Einschätzung, die auch Prof. Haak teilt. Daraus ergibt sich die grundlegende Frage: Sollen Prozesse konsequenter standardisiert oder bewusst individuell gehalten werden? Die Debatte um unterschiedliche Viskositäten bringt diese Thematik beispielhaft auf den Punkt. Tetric plus Flow zeigt mit seiner innovativen Formulierung einen vielversprechenden Weg auf: Dank adaptiver Fließeigenschaften passt sich das Material flexibel an verschiedene Anforderungen an – und unterstützt so sowohl standardisierte Abläufe als auch individuelle Techniken.
Spiegel der aktuellen Entwicklungen
Tetric plus Fill und Tetric plus Flow stehen stellvertretend für die aktuellen Entwicklungen in der Komposit-Technologie: praxisnahe Universalität, anwenderfreundliches Handling und intelligente Materialeigenschaften, die sich situativ anpassen lassen. Die Erfahrungsberichte aus Praxis und Lehre zeigen zugleich: Jede Innovation erfordert Aufklärung, Schulung – und oft auch eine gewisse Lernkurve. Die Zukunft liegt in einer ausgewogenen Verbindung von Standardisierung und Individualisierung – angepasst an die Vielfalt zahnärztlicher Arbeitswelten.
21 Empfehlungen der Expertinnen und Experten für Workflow, Materialwahl & Zukunftssicherheit
Die von den Expertinnen und Experten formulierten 21 praxisorientierten Statements bieten Zahnärztinnen und Zahnärzten praxisnahe Handlungsempfehlungen für den klinischen Workflow bei direkten Restaurationen und benennen zentrale Anforderungen an moderne Füllungsmaterialien aus Komposit – basierend auf den Aussagen des Experten Hearings am 5. Mai 2025 in Berlin. Die Statements sind thematisch geordnet und auf den klinischen Alltag zugeschnitten.
Statements zum Themenfeld „Handhabung & Verarbeitung: Effizienz, Einfachheit, Sicherheit“
- Weniger Schritte, mehr Sicherheit: Komposite mit kurzen Aushärtungszeiten (zum Beispiel drei Sekunden) vereinfachen den Workflow und reduzieren Fehlerquellen – ideal bei Zeitdruck im Praxisalltag.
- Vier-Millimeter-Schichttechnik spart Zeit: Moderne Bulk-Fill-Materialien ermöglichen das Legen dickerer Schichten ohne Qualitätsverlust – besonders geeignet für Zeitersparnis bei posteriorem Lückenschluss.
- Techniksensibilität reduzieren: Materialien mit gutem Handling und geringer Klebrigkeit (Stickiness) lassen sich einfacher modellieren – entscheidend für reproduzierbare Ergebnisse auch bei wechselnden Assistenzteams.
- Gute Polierbarkeit schafft Ästhetik: Komposite mit hoher Oberflächengüte nach der Politur sichern ästhetisch ansprechende und hygienefähige Restaurationen – besonders relevant im Frontzahnbereich.
- Lichtverhältnisse berücksichtigen: Für zuverlässige Polymerisation ist nicht nur die Belichtungszeit, sondern auch die Lichtintensität entscheidend – ausreichende Gerätewartung ist Pflicht.
- Materialien mit thixotropem Verhalten nutzen: Solche Komposite fließen nur bei Druck – sie bieten eine bessere Kontrolle in der Applikation und mehr Präzision an Rändern und Kanten.
- Einfachere Farbauswahl: Universalkomposite mit gutem Farbangleich reduzieren die Auswahlkomplexität und verbessern die Vorhersagbarkeit des Ergebnisses.
- Reparierbarkeit bedenken: Reparaturmöglichkeiten verlängern die Lebensdauer von Restaurationen und ermöglichen einen zahnschonenderen Umgang bei kleinen Defekten.
Themenfeld 2: Qualitätsorientierung und Qualitätssicherung
Im Rahmen der Diskussion wurden die Möglichkeiten, sich an der S3-Leitlinie zur Füllungstherapie bei den klinischen Abläufen zu orientieren, kritisch hinterfragt. Prof. Haak sieht in den Leitlinien eher Leitplanken – sie zeigen auf, was nicht getan werden sollte, bieten jedoch kaum praktikable Hilfestellung für eine gute klinische Umsetzung. Auch den Fokus auf die Lebensdauerbetrachtung von verschiedenen Restaurationsmaterialien und -arten kommentierte er kritisch. Relevant sei nicht nur die Langlebigkeit der Füllung, sondern die Langzeitgesundheit des Zahns und des gesamten oralen Systems.
„Als eine der Autorinnen der Leitlinie“, betonte Prof. Frese, „ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, die aktuell vorliegende Evidenz zu bewerten.“ Nur so könne eine fundierte und zugleich praxisnahe Orientierung für den klinischen Alltag entstehen.
Versagen, Erfolg und der Faktor Mensch
Die Diskussion um Versagen von Kompositrestaurationen offenbarte die Diskrepanz zwischen Literatur und klinischer Realität. Während Studien häufig strukturell definierte Misserfolge wie Randfrakturen oder Füllungsverlust thematisieren, steht in der Praxis Sekundärkaries als Hauptursache im Vordergrund – bedingt durch Patientenverhalten, Mundhygiene und Kariesaktivität. Dr. Firas Chakroun betonte, dass kariöse Läsionen im Alltag eine weitaus größere Rolle spielen, als es in der Literatur den Anschein hat.
Dr. Carola Pentelescu warf die Frage auf, wie „Versagen“ überhaupt definiert werden sollte: „Ist jede Reparatur bereits ein Misserfolg oder beginnt Misserfolg erst beim kompletten Ersatz?“ Prof. Cornelia Frese schlug daher vor, zwischen Total- und Teilversagen zu differenzieren, analog zur Bewertung von Überlebensraten.
Einigkeit bestand darüber, dass die Qualitätssicherung multifaktoriell ist: Neben Material, Technik und Zeitaufwand spiele der Patientenfaktor eine zentrale Rolle. Dr. Stephanie Huth beschrieb den Ablauf in der Praxis: „Zunächst erfolgt eine Prophylaxesitzung, bevor überhaupt restauriert wird. Damit kann Mundhygiene optimiert und das Risiko für Rezidive gesenkt werden.“
Gesundes Milieu als neuer Fokus
Auch die Diagnostik sei entscheidend und Randverfärbungen würden unterschiedlich interpretiert. „Während manche direkt zum Austausch greifen, sondieren andere vorsichtig oder dokumentieren den Verlauf via Intraoralkamera“, erläuterten die Fachleute.
Neben Materialfragen werde die Rolle des oralen Mikrobioms zunehmend diskutiert. Dr. Pentelescu stellte infrage, ob sich ein gesundes Milieu durch Materialien positiv beeinflussen lässt – sei es durch antibakterielle Eigenschaften oder „probiotisch gedachte“ Ansätze. Prof. Haak brachte den Gedanken ein, dass Gesundheit auch durch Einflussnahme auf das lokale Milieu entstehen könne – ein Aspekt, der über rein mechanische oder chemische Materialeigenschaften hinausgeht.
Anforderungen an neue Materialien – zwischen Anspruch und Realität
Die Diskussion um die physikalischen Eigenschaften moderner Komposite verdeutlichte, wie vielschichtig und global differenziert Anforderungen betrachtet werden müssen. Dr. Bielec betonte: „Wir müssen bei Biegefestigkeit und Langzeitstabilität kompromisslos bleiben.“ Bei anderen Parametern wie der Röntgenopazität hingegen sei man bereit, Zugeständnisse zugunsten anderer Vorteile zu machen. Dr. Pentelescu kritisierte, dass klinische Fragestellungen oft nicht ausreichend beantwortet werden können – unter anderem wegen ethischer und regulatorischer Hürden. In-vitro-Ergebnisse seien oft nicht auf den klinischen Alltag übertragbar.
Klinische Studien brauchen Zeit
Zudem stellt sich die Frage: Wie viel Fortschritt ist in welchem Tempo überhaupt realistisch? Prof. Haak sah die Herausforderung in der Umsetzbarkeit. Klinische Studien benötigen oft viele Jahre – dennoch erwarten Anwender kontinuierlich Innovationen. Bei der Perspektive der Materialentwicklung machte Philipp Bielec deutlich: „Komposite sind keineswegs ausentwickelt.“ Vielmehr gelte es, vorhandene Schwächen gezielt zu kompensieren – mit evolutionären wie auch revolutionären Ansätzen.
Der Trend zur Biokompatibilität gewinnt an Bedeutung – ebenso wie die Nachfrage nach besonderen Materialeigenschaften, zum Beispiel vegan, glutenfrei oder hypoallergen. Diese Anforderungen werden zunehmend auch von Patientenseite artikuliert – und beeinflussen die Entwicklungsarbeit ebenso wie die Vermarktung.
Qualitätsorientierung ist mehrdimensional
Qualitätsorientierung in der Komposittherapie ist mehrdimensional: Sie beginnt bei der Wahl des richtigen Materials, erfordert ein tiefes Verständnis für das orale Milieu und mündet in einer patientenzentrierten, nachhaltigen Versorgung.
„Gute Füllungen" entstehen nicht allein durch Technik – sondern im Zusammenspiel von Wissenschaft, klinischer Erfahrung und individueller Patientenführung.
Statements zum Themenfeld „Qualitätsorientierung & Qualitätssicherung“ – Nachhaltigkeit & Präzision im Blick
- Langlebigkeit der gesamten Struktur im Blick behalten: Ziel ist nicht nur eine haltbare Restauration, sondern die Erhaltung des gesamten Zahns – Materialien müssen funktionell und biokompatibel sein.
- Reparatur statt Ersatz: Wo immer möglich, sollte repariert statt komplett ersetzt werden – das ist nachhaltiger und patientenfreundlicher.
- Fehlerminimierung durch Workflow-Vereinfachung: Je standardisierter die Abläufe und je kompatibler die Materialien, desto geringer das Risiko für klinische Fehler.
- Füllungsversagen neu definieren: Teilversagende Restaurationen (zum Beispiel durch Randleistenfrakturen) können heute gezielt repariert und erhalten werden – regelmäßige Kontrolle und Nacharbeit sind Bestandteil der Qualitätssicherung.
- Kariesrezidive früh erkennen: Eine visuelle und ggf. vorsichtige taktile Kontrolle und intraorale Fotos zur Monitoringunterstützung helfen bei der Einschätzung von Veränderungen und ob zum Beispiel Verfärbungen kariesrelevant sind.
- Materialwahl nach Indikation differenzieren: Flowables eignen sich ideal als Liner oder hydrophobe Abdeckung der Adhäsivschicht oder für Klasse-V-Restaurationen. Die Langzeitstabilität für stark belastete okklusionstragende Bereiche sollte noch in klinischen Studien über längere Zeiträume beurteilt werden.
- QM und MDR im Blick: Moderne Materialien sollten eine nachvollziehbare Dokumentation und Indikationsklarheit aufweisen – das erleichtert den Praxisalltag im Rahmen der Qualitätssicherung.
- Kompatibilität sichert Workflow-Stabilität: Füllungsmaterialien sollten optimal auf Adhäsive, Liner und Poliersysteme abgestimmt sein – idealerweise innerhalb eines Materialsystems desselben Herstellers. Das minimiert Wechselwirkungen, vereinfacht die Anwendung und erhöht die Prozesssicherheit.
Themenfeld 3: Wissenstransfer und Zukunftsperspektive – aktueller und zukünftiger Workflow in der Zahnmedizin
Die Vision einer „wellness-orientierten Zahnmedizin“, wie Dr. Firas Chakroun formulierte, prägte maßgeblich die Diskussion um zukünftige Versorgungsmodelle. „Unsere Patienten erwarten heute nicht nur Schmerzfreiheit, sondern eine angenehme, angstfreie Atmosphäre.“ Das klassische Bild der Zahnarztpraxis wandelt sich zunehmend hin zu einem ganzheitlich ausgerichteten Gesundheits- und Wohlfühlort.
„Es ist nachvollziehbar, dass diese Nähe auf dem Behandlungsstuhl zu Unbehagen führt.“ Der Zahnarzt dringt in die Comfortzone des Patienten ein und so „verstärkt der Verlust des physischen Abstands, Stichwort: 30-Zentimeter-Abstand die Angst.“
Komfort und Technik im Verbund
Die zahnmedizinische Versorgung der Zukunft wird durch eine Kombination aus Komfort, Ästhetik und digitaler Unterstützung geprägt sein, sind sich die Fachleute einig. Mögliche Elemente eines solchen modernen Workflows sind:
- Zuhause-Monitoring durch smarte Zahnbürsten
- Früherkennung über Speicheltests und Intraoralscanner
- Videounterstützung während der Behandlung
- Behandlungsräume ohne klassische Zahnarztstühle, mit Fokus auf Entspannung
- und technische Integration.
Kommunikation als Schlüssel zur Vertrauensbildung
Ein zentrales Element des modernen Behandlungsalltags ist die Kommunikation auf Augenhöhe:
- Patienten sollten aktiv in die Diagnostik eingebunden werden, zum Beispiel durch das gemeinsame Betrachten von Röntgen- oder Intraoralbildern.
- Die Kommunikation im Behandlungsteam sollte für alle Patienten verständlich bleiben – ohne unverständliches „Fachchinesisch“.
- Transparenz und Nachvollziehbarkeit fördern und stärken Vertrauen und ermöglichen eine bessere Steuerung des Behandlungsprozesses. Prof. Haak betonte: „Wir handeln unter Unsicherheit – das ist Medizin. Aber wir können Kontrollsysteme schaffen, die Fehler abfangen.“
- Die Zahnarzt-Assistenz-Kommunikation sollte für Patient:innen verständlich sein – statt „Fachchinesisch“ über ihren Kopf hinweg.
- Transparenz stärkt das Vertrauen und ermöglicht eine bessere Steuerung des Behandlungsprozesses.
Wandel durch Telemedizin, KI & digitale Tools – Chance und Herausforderung
„Internationale Entwicklungen zeigen, dass telemedizinische Erstdiagnosen und digitale Workflow-Unterstützung auch in der Zahnmedizin an Bedeutung gewinnen“, erwähnte Dr. Chakroun. Gleichzeitig entstünden mit dem Wandel durch Telemedizin, Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Tools neue Herausforderungen. Die Einschränkung nonverbaler Kommunikation bei virtuellen Beratungen beispielsweise erfordert neue kommunikative und digitale Kompetenzen, sowohl auf Seiten der Behandler als auch bei Patienten.
Ausbildung muss tatsächlichen Workflow spiegeln
Ein wiederkehrender Appell der Teilnehmenden lautete: Die Ausbildung muss den tatsächlichen Workflow widerspiegeln – strukturiert, reproduzierbar und praxistauglich. Ziel sei es, eine sichere Anwendung durch alle Beteiligten zu gewährleisten – nicht nur durch eine kleine exklusive Expertengruppe (Prof. Haak: „Nicht nur die sieben Experten hinter den sieben Bergen dürfen damit klarkommen!“).
Schlüsselthemen für Schulungen und Fortbildungsangebote sind:
- Vereinfachung statt Überkomplexität
- Integration von Resilienztraining
- Verkaufskompetenz und transparente Leistungsdarstellung (Wie vermittle ich nachvollziehbar den Wert meiner Leistung?)
- Monitoring-Konzepte, zum Beispiel auf KI-Basis, die eine langfristige Betreuung ermöglichen (zum Beispiel bei Initialkaries oder funktionellen Veränderungen)
- Regeneration statt Invasivität
Ein persönlicher Erfahrungsbericht veranschaulichte ein Beispiel für eine zukunftsweisende, minimalinvasive Strategie, das auf der Monomer-Peptid-104-Technologie basiert (Curodont, vVardis, Schweiz). Es steht für eine biomimetische Zahnerhaltung und eine Zukunftstechnologie im Sinne einer Regeneration statt Invasion.
Diese Entwicklungen zeigen exemplarisch, wie moderne Materialien und Technologien künftig sinnvoll in Diagnostik, Indikationsstellung und Patientenkommunikation integriert werden können, und zwar als Teil eines umfassenden, patientenorientierten Versorgungskonzepts.
Statements zum Themenfeld „Wissenstransfer & Zukunftsperspektive“ – heute beginnen, morgen profitieren
- Einfachheit fördern, aber Individualität ermöglichen: Materialien sollen leicht in standardisierte Abläufe integriert werden, aber Raum für klinische Präferenzen lassen (zum Beispiel unterschiedliche Kanülenformen).
- Praxisgerechte Fortbildung anbieten: Mitarbeiterschulungen und Team-Trainings zum Umgang mit neuen Materialien sichern langfristige Qualität und reduzieren Einarbeitungszeiten.
- Mehr Flow, mehr Optionen: Der Trend geht zu einem häufigeren Einsatz von Flowables und zur rein injektiven Technik.
- Biokompatibilität wird zentral: Patientenfragen zu veganen, allergenarmen oder mikrobiomfreundlichen Materialien nehmen zu – Hersteller und Praxen sollten vorbereitet sein.
- Innovationen brauchen Zeit – und Nutzenkommunikation: Neue Materialien durchlaufen langjährige Prüfprozesse. Der Benefit für die Praxis muss klar und verständlich kommuniziert werden – sowohl im Team als auch gegenüber den Patienten.
Fazit: Alle müssen den Wandel mitgehen können
Die Zukunft der Zahnmedizin liegt in einem workflowbasierten, patientenzentrierten und digital unterstützten Gesamtsystem, das Ästhetik, Prävention, Zahngesundheit und die allgemeine Gesundheit sowie Kommunikation miteinander vereint. Zahnmedizin wird zunehmend als integraler Bestandteil eines ganzheitlichen Gesundheitskonzepts verstanden. Entscheidend ist, dass alle Beteiligten – von Studierenden über zahnärztliche Teams bis zu Patienten – diesen Wandel mitgehen können. Standardisierte, aber flexible Workflows, eine neue Kommunikationskultur und smarter Wissenstransfer sind der Schlüssel.
Moderne Komposite vereinen einfache Handhabung, hohe Ästhetik und zukunftssichere Materialeigenschaften. Mit einer bewussten Materialauswahl und einem klar strukturierten Workflow können Zahnärzte und ihre Teams Zeit sparen, Fehler vermeiden und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards erfüllen.
Dr. Aneta Pecanov-Schröder, Bonn