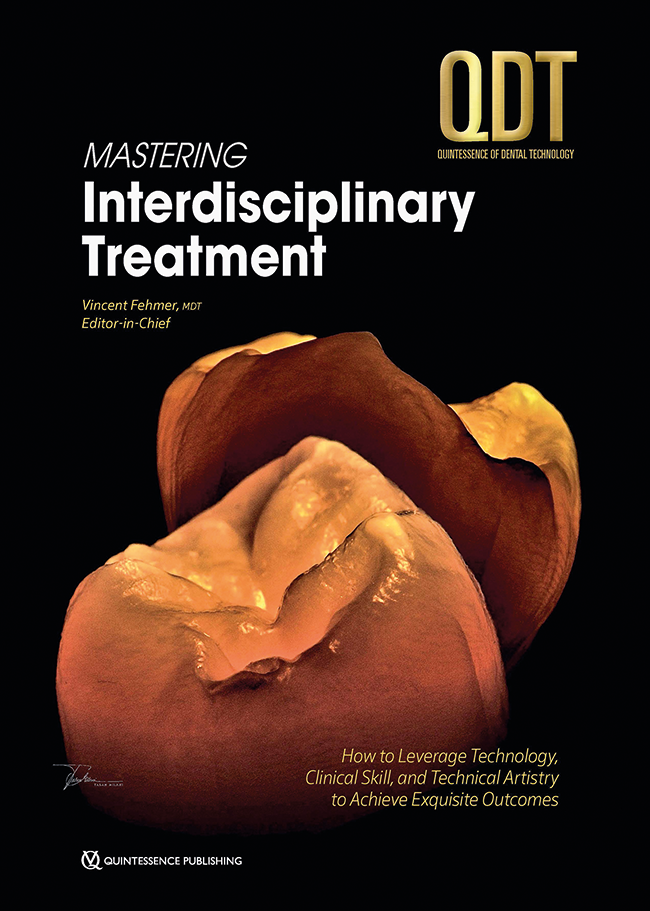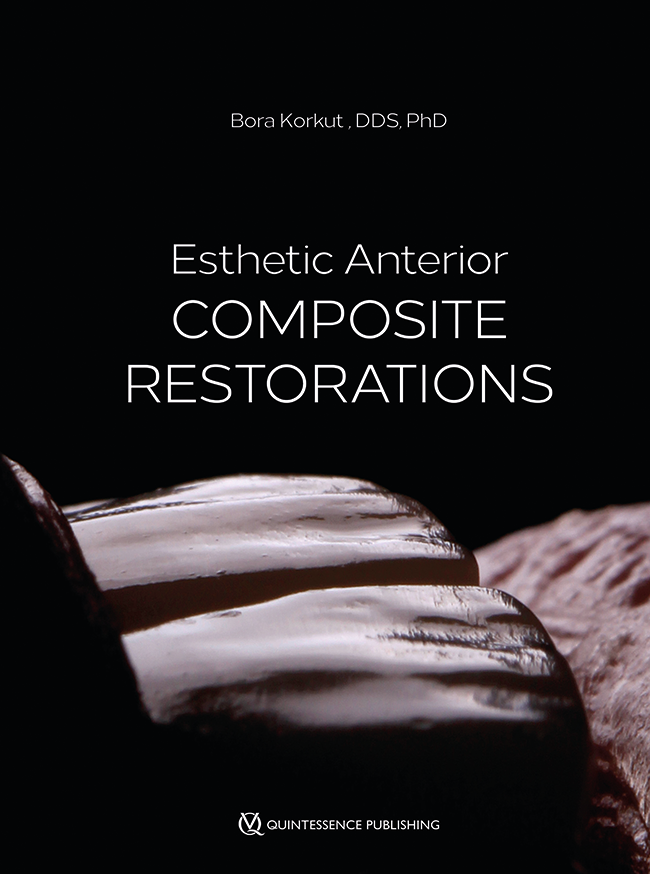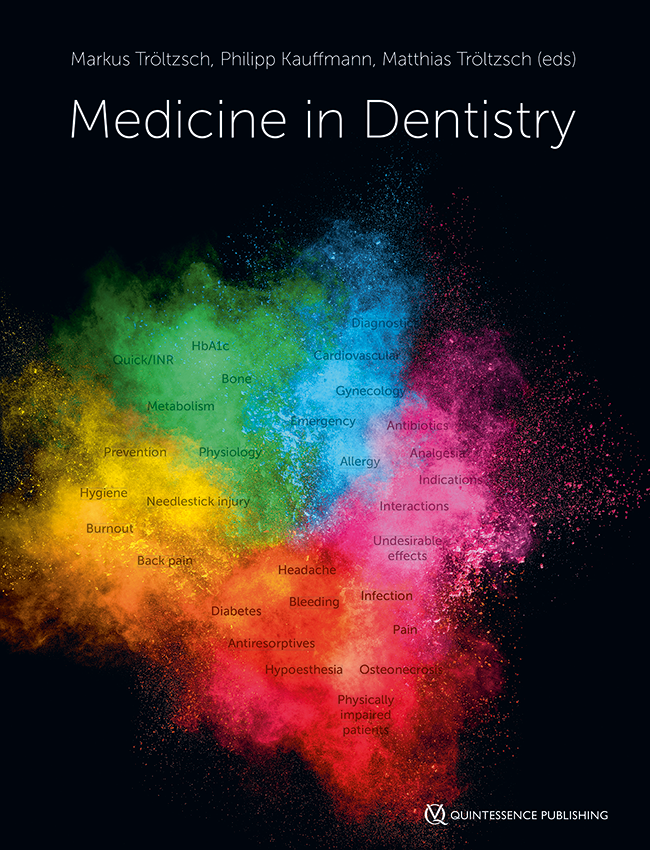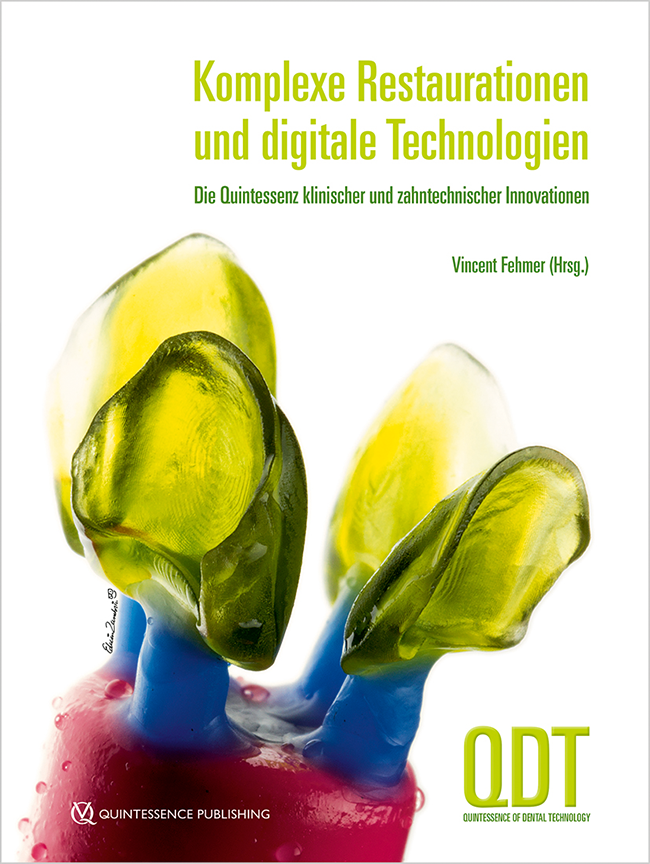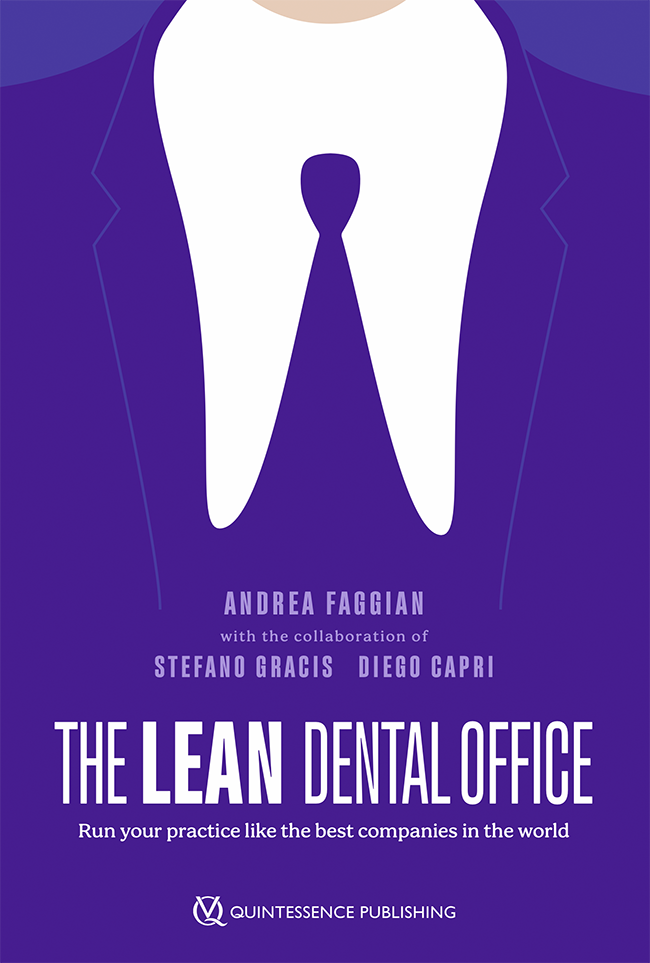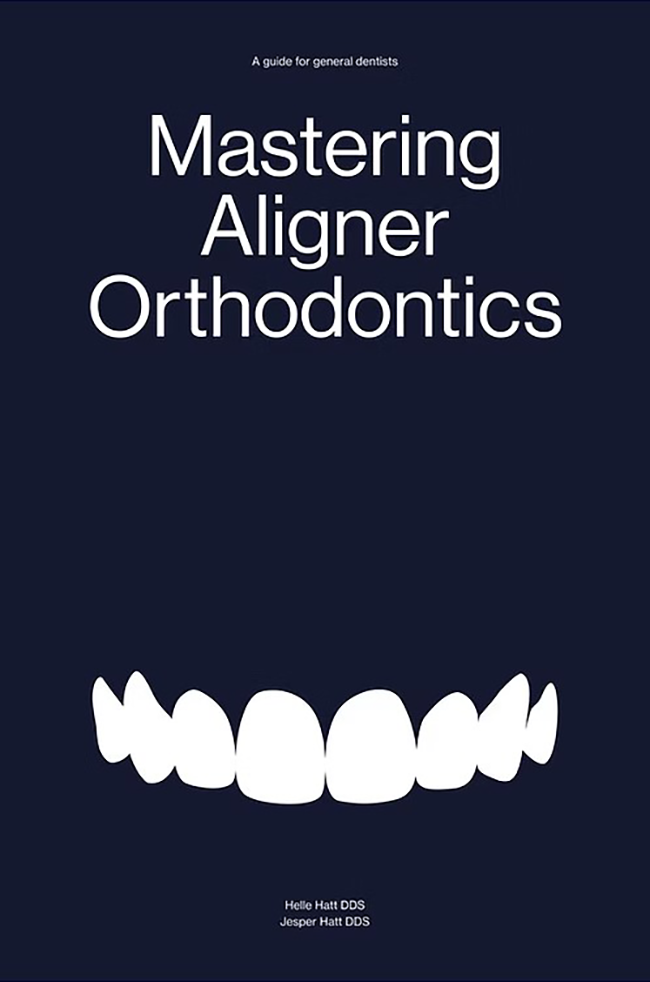„Der Generalist als Spezialist“: rund 300 Zahnärztinnen und Zahnärzte hatten den Weg ins Estrel Convention Center in Berlin zum Berliner Zahnärztetag mit diesem Thema gefunden und wurden mit einem reichhaltigen Programm und vielen interessanten Informationen und Diskussionen belohnt. Dr. Derk Siebers hatte gemeinsam mit dem gastgebenden Quintessenz Verlag für die 39. Ausgabe des traditionsreichen Kongresses hoch kompetente Referentinnen und Referenten für die ganze Bandbreite der alltäglichen zahnärztlichen Tätigkeit und Entscheidungsfindung gewinnen können.
Abgedeckt wurden die Themen Prothetik, Implantologie und Zahntechnik, Generalisten, zahnärztliche Schlafmedizin und Grenzen und Möglichkeiten der Zahnerhaltung in Endodontie und Parodontologie. Die Digitalisierung und neue Erkenntnisse und Möglichkeiten spielten in allen diesen Themen eine wichtige Rolle.
Save the date: 40. Berliner Zahnärztetag 2026
Der nächste Berliner Zahnärztetag wird ein Jubiläumskongress: Am 13. und 14. März 2026 heißt es zum 40. Berliner Zahnärztetag „Zahnmedizin im Wandel – Impulse, Innovationen und interdisziplinäre Perspektiven für eine gesunde Zukunft“. Dr. Derk Siebers und Dr. Holger Janssen werden dazu nicht nur für die Berliner Zahnärztinnen und Zahnärzte ein interessantes und überraschendes Programm präsentieren. Für Programmdetails und zur Anmeldung hier entlang.
Hat der Generalist eigentlich noch eine Chance, angesichts der vielen Differenzierungen und Spezialisierungen in der Zahnmedizin? Oder gehört die Zukunft dem Spezialisten? Die Antwort auf diese Frage lautet: Sowohl als auch. Die Zahl der niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte sinkt, in vielen Regionen sind die Generalisten die erste und wichtigste Anlaufstelle der Patientinnen und Patienten, weil es dort gar nicht so viele Spezialisten gibt.

Foto: Quintessenz
Klar wurde auch schnell: Die Generalisten unter den Referentinnen und Referenten haben alle ihre Schwerpunkte und Spezialisierungen – und sie suchen und brauchen die Ergänzung durch andere Kolleginnen und Kollegen, die andere Schwerpunkte einbringen. Oft direkt in der eigenen Praxis oder im Netzwerk mit anderen Praxen und Zentren. Dazu gehört aber auch die Bereitschaft zur Fortbildung und zum kollegialen Austausch.
Wer als Generalist viele Bereiche abdecken will und muss, sollte zudem seine Prozesse klar aufstellen und gemeinsam mit dem Team immer wieder bearbeiten. Das sei „sauviel“ Arbeit, so Dr. Ferdinand Tieck aus Hamburg, aber es sei ein Muss. Denn nur mit gut strukturierten Prozessen für die verschiedenen Abläufe und Therapiekonzepte, die das Team auch beherrsche und mitgestalten könne, seien die gewünschten guten Behandlungsergebnisse überhaupt möglich und die Arbeit als Generalist zu schaffen. Das bekräftigte auch Beckmann.
Was die Digitalisierung bringt
Was bringt die viel beschworene Digitalisierung denn für die Praxis und für die Patienten? Prof. Dr. Jan-Frederik Güth und ZTM Udo Plaster beantworteten die Frage in der Session zur Prothetik zurückhaltend. Denn auch die digitalen Tools brauchen Zeit, Know-how und Geld – und nicht alles, was heute möglich ist und propagiert wird, bringt am Ende auch einen wirklichen Vorteil, Stichwort 3D-Druck.
Wirklich sinnvoll seien für den Generalisten die digitale Bildgebung und auch der Einsatz eines Intraoralscanners. Aber auch hier braucht es eine Lernkurve, um die Vorteile wirklich nutzen zu können, so Güth. Kleine Faustregel: Wenn es digital weitergeht, dann scannen. Geht es im Labor analog weiter, dann kann man auch analog abformen. Für Einzelzahnversorgungen auf Zahn oder Implantat sei digital heute ein Muss.
Was die Genauigkeit der Scanner angeht, müsse man bei den konventionellen analogen Abformungen korrekterweise auch die Fehler in den weiteren Arbeitsschritten bis zum Modell addieren. Am Ende komme es darauf an, den für die eigenen Anforderungen geeigneten Scanner auszuwählen und die Scanpfade und Routinen der Hersteller einzuhalten.
Tipps für gute Scandaten
Gemeinsam mit Udo Plaster, der in seinem Vortrag kritisch auseinandersetzte, wie sich Funktionsparameter heute in analoge oder digitale Workflows umsetzen lassen und welche Vorteile der (teil-)digitale Workflow gerade für Therapieverfahren mit Korrektur von Bisshöhe und Okklusion bringt, gaben sie in der Diskussion des ersten Themenblocks viele Tipps für den Alltag. So sei es wichtig, die Datensätze vor Versand kritisch zu prüfen, ob alles korrekt erfasst ist. Ist eine Stelle nicht ausreichend erfasst, dann nicht x-mal drüberscannen, sondern die Stelle aus dem ersten Scan ausschneiden und neu scannen.
Beide machten klar, dass das zu scannende Gebiet möglichst trocken sein sollte, um alle Strukturen sauber erfassen zu können – Speichelpfützen sind nicht hilfreich. Ganz wichtig: Die gute und ehrliche Kommunikation zwischen Zahnarztpraxis und Labor.
Spezialisten nicht digitaler unterwegs als Generalisten
Das diskutierten und belegten auch die Referententeams im Themenblock Implantologie. Die Sicht der Hochschule – in diesem Fall Freiburg – boten Prof. Dr. Tobias Fretwurst und Junior-Prof. Dr. Florian Kernen, die zum Einstieg die Ergebnisse einer Befragung präsentierten. Danach sind 50 Prozent der Generalisten heute mit einem digitalen OPG und einem Intraoralscanner ausgestattet und nutzen das für implantologische Versorgungen auch. Je größer die Stadt, desto digitalisierter die Generalisten, und wer digital unterwegs ist, nutzt zu 50 Prozent auch die CAM-Fertigung von Bohrschablonen, Provisorien und Restaurationen.
Die auf Implantologie spezialisierten Zahnärzte dagegen nutzen nur zu gut 27 Prozent digitale Tools, und 50 Prozent davon arbeiten dann mit Schablonen in der Praxis – für Pilot guided, Fully Drill guided und Fully Implant Guide. Aber viele arbeiten weiterhin Freihand bei der Implantatinsertion. Eine dynamische Navigation wird noch kaum genutzt, auch mit Robotern kann man sich noch nicht anfreunden – aber beides werde kommen, so die Referenten. Haupthinderungsgrund für digitale Anwendungen: die Kosten.
Planung und Fertigen der Bohrschablonen extern
Ihre Empfehlungen: Nicht jeder Fall braucht eine digitale Planung, aber jede digitale Planung braucht eine Indikation. Sie rechnen in der Klinik nach vollständiger Erhebung aller Daten mit drei Wochen Vorlauf und lassen die Planung und die Bohrschablone extern erstellen. Warum? Kernen sieht vor allem die durchaus komplexeren Abläufe beim Drucken von Schablonen für die Praxis als ungeeignet an – das könne ein spezialisiertes Labor/ein externer Dienstleister deutlich schneller und besser. Und auch spezialisierte Planungsdienstleister lieferten in kürzerer Zeit gute Grundlagen, die der Behandler dann final freigebe.
Wer digital arbeiten wolle, sollte mit kleinen Fällen anfangen. Für die schablonengeführte Implantologie brauche man nur eine minimale Ausstattung. Nur ohne chirurgisches Grundwissen gehe gar nichts. (Ein Grundlagenbuch zur Implantologie, gemeinsam herausgegeben von Katja Nelson und Tobias Fretwurst, ist gerade im Quintessenz Verlag erschienen.)
Vorsicht vor zu hohen Patientenerwartungen
Wie Implantatversorgung im Zusammenspiel von Zahnarzt und Zahntechniker erfolgreich funktioniert, damit begeisterten dann Dr. Peter Gehrke und ZT Carsten Fischer als zweites Vortragsteam dieses Blocks. Ganz wichtig laut Gehrke: Herauszufinden, „wer nicht meine Patientin/mein Patient ist, wo ich die Wünsche nicht erfüllen kann“. Denn Patientenerwartungen seien oft unrealistisch und seien auch durch Veröffentlichungen und Social Media noch höher geworden. Ein intensives Beratungsgespräch sei daher unbedingt nötig – auch ein wichtiges Feld für den Generalisten.
Standardisierte Protokolle wichtig
Beiden ebenfalls sehr wichtig: Standardisierte Protokolle von Befunderhebung bis finale Versorgung, um im Team strukturiert arbeiten zu können. Das bedeute aber nicht Standardtherapien, denn jeder Fall sei individuell, die Therapie müsse angepasst werden.
Es brauche etablierte Workflows zwischen Praxis und Labor, beide müssten sich immer wieder absprechen, wie was abgebildet wird, welche Materialien und Abutments genutzt werden. Das erfordere sehr viel Wissen über den aktuellen Stand und sichere Versorgungen etc. Dabei helfe auch die Digitalisierung.
Und auch die Visualisierung biete Vorteile – aber vor allem in der Zusammenarbeit von Zahnarzt und Zahntechniker, denn die Facescans seien für viele Patientinnen und Patienten eher abschreckend. Für eine individuelle Präsentation sei das Matchen mit Fotos besser. „Vorsicht vor dem digitalen Versprechen“, so Gehrke. Man solle nur zeigen, was man auch realisieren könne.
Abutments müssen gereinigt werden
Beiden ebenfalls ein Anliegen: das gründliche Reinigen der Abutments vor dem Einsetzen – dazu haben sie auch bereits Beiträge veröffentlicht. Ein weiteres Thema: neue Scanbodies mit sogenannten Scanflügeln, die bei zahnlosen Kiefern eine genaue Übertragung der Implantatpositionen im Scan ermöglichen.
In der Diskussion mit Derk Siebers und Co-Moderatorin Prof. Dr. Tabea Flügge hoben beide Referententeams auf Scans als Dokumentationstools ab, ebenso auf die doch begrenzte Lebensdauer von Implantaten – „warum nicht auch in der Implantologie von ‚Ersatzimplantationen‘ reden, weil sie eben nicht immer lebenslang halten“, so die Frage.
Generalisten und ihr Spezialistenblick
Anita Beckmann bereitete nicht nur das Thema Generalistin auf, sie stellte auch ihr Spezialthema vor: orale Restriktionen. Dieses in Deutschland noch recht junge Thema führte sie mit einigen Patientenfällen ein, die zeigten, wie sehr dieser durchaus generalistische Spezialistenblick zu Lösungen komplexer Symptombilder führt. Nicht nur das restriktive Zungenband (dazu ist im Quintessenz Verlag gerade ein Buch erschienen), auch andere orale Strukturen können zum Beispiel zu schlafbezogenen Atemstörungen bei Kindern und Erwachsenen führen. Mit sogenannten Balancern, Logopädie etc. könne vielen dieser Patienten geholfen werden. Es ist wichtig, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte diese Probleme erkennen könnten, um die Patienten bei Problemen schon sehr früh mit generalistischem Wissen steuern zu können, so Beckmann.
Weiterlernen, Netzwerke aufbauen
Vertieft wurde das Thema „Generalist“ von Dr. Ferdinand Tieck, der sozusagen als „spezialisierter“ Generalist über seine Leidenschaften Endodontie, Implantologie, Chirurgie und ästhetische Füllungstherapie sprach. Dabei wurde deutlich, wie stark der Wunsch nach Weiterlernen, die Arbeit mit Spezialisten und ein gutes Expertennetzwerk – für ihn unter anderem die „Neue Gruppe“ – die erfolgreiche Arbeit als Generalist mit Spezialisierung triggert. „Es ist der beste Job der Welt“, so sein Fazit, auch wenn es viel Arbeit sei und nicht immer leicht, die richtige Balance zwischen Praxis und Familie zu halten.
Atembezogene Schlafstörungen sind wichtiges Thema für die Praxis
Die zweite Session am Samstag war für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer offensichtlich ein heißes Thema: Zahnärztliche Schlafmedizin. Schon die Einführung durch Dr. Samia Little Elk gab eine große Fülle praktischer Tipps, um atembezogene Schlafstörungen bei den eigenen Patientinnen und Patienten (und vielleicht auch sich selbst und in der Familie) zu erkennen. Ein wichtiger Hinweis aus einer Studie der Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Somnologin: Bei einer nicht kleinen Anzahl von Menschen, die (erfolglos) auf Burnout therapiert werden, liegen den Problemen doch eine obstruktive Schlafapnoe(OSAS)/schlafbezogene Störungen zugrunde.
Tagesbefinden gibt Aufschluss
Die grundlegende Frage sei nicht „schlafen Sie gut“, sondern wie ist das Befinden am Tag. Wichtige Indikatoren seien zum Beispiel Tagesmüdigkeit, Sekundenschlaf, Immunschwäche, aber auch ein erhöhtes Körpergewicht, das durch Bewegung und Nahrungsumstellung nicht verringert werden könne, morgendliche Kopfschmerzen und nächtliche Panikattacken. Das Übergewicht fördere OSAS, aber zugleich führten die nächtlichen Atemaussetzer zu einem erhöhten Cortisolspiegel, der wiederum das Abnehmen erschwere. Viele Patienten, die bei einer leichten bis mittleren OSAS mit einer Unterkieferprotrusionsschiene (UPS) versorgt werden, würden dann auch Gewicht verlieren, so ihre Beobachtung.
Atemwegsorientierte Zahnheilkunde
Dr. Christian Leonhardt widmete sich in seinem Vortrag vertiefend der atemwegsorientierten Zahnheilkunde – einem selbst in der Kieferorthopädie noch wenig beachteten Thema, bei dem der Generalist/die Generalistin durch die enge Begleitung der Patienten früh Probleme erkennen könne und vor allem Probleme durch eine falsche Therapieentscheidung vermeiden könne. Schlagend zeigte er dies am Beispiel eines Patienten, der mit dem Wunsch nach einer ästhetischen Korrektur eines lückigen Zahnstands in die Praxis kam und nach einer Aligner-Therapie zwar ästhetisch zufrieden war, aber dann Atem- und Schlafprobleme bekam. Die finale Lösung bestand in einer Rückführung der Zahnstellung und einer konventionellen Korrektur mit Kompositen/Veneers.
Früh auf mögliche Probleme achten
Leonhardts Appell: Probleme früh erkennen, auf Platz, Funktion und Kieferfunktionen schon bei Kindern achten, denn zu enge Kiefer würden sich eben nicht zurechtwachsen. Zungenfunktion, Schluckmuster, der Stand der Zähne im Kieferknochen etc. seien wichtige Indikatoren für mögliche Störungen, die dann bei den Patienten zu Atemproblemen führen. „Form follows function“, so Leonhardt. Die Zunge brauche ausreichend Platz, auch bei Erwachsenen. Dort sei die Korrektur aber viel aufwendiger, bis hin zu LeFort-Operationen. Zum Thema gibt es ein aktuelles Buch und im Oktober 2025 auch den Vienna Airway Congress in Wien.
Grenzen des Zahnerhalts immer weiter hinausgeschoben
Die letzte Session galt dem Zahnerhalt, und sie wurde von zwei absoluten Spezialisten mit viel Input und Begeisterung gestaltet. Wann ist ein Zahn endodontisch oder parodontologisch nicht mehr erhaltungswürdig? Diese Antwort könne man eigentlich kaum noch pauschal geben, so der Endodontologe Dr. Jörg Schröder, denn die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten entwickelten sich immer weiter und schieben die Grenzen des Zahnerhalts immer weiter hinaus.
Vor dem Hintergrund, dass trotz einer weit entwickelten Implantologie das Implantat nicht mehr als schneller Ersatz eines Zahns, sondern als letzte Therapieoption gesehen werden sollte, sei dies auch eine positive Entwicklung. Was dreidimensionale Bildgebung, moderne Konzepte und vor allem Überlegung auch bei Revisionen für den Erfolg leisten, zeigte er an diversen Fällen – vom scheinbar „einfachen“ Frontzahn bis zum komplexen Molaren.
Von der pauschalen Empfehlung zur personalisierten, individuellen Therapie
Ein wahres Feuerwerk aus Jahrzehnten Erfahrung in Implantologie und Parodontologie brannte dann zum Schluss Prof. Dr. Marc Hürzeler ab. Sein Konzept einer patientenorientierten personalisierten Zahnmedizin, das er gemeinsam mit Dr. Otto Zuhr im neuen dreibändigen Buch sozusagen als Essenz ihres Berufslebens zusammengefasst hat, bringt auch einen neuen Blick auf das Thema Zahnerhaltung und ihren Wert.
Anschaulich machte er dies anhand der Langzeitergebnisse mehrerer Patientenfälle. Ende der 1990er Jahre sei – suggeriert von der Industrie – die verbreitete Denkweise gewesen: Implantate sind bessere Zähne. Folglich hätten sie sehr viele Zähne durch Implantate ersetzt, die sie heute erhalten würden. Nach mehr als 25 Jahren sehen die erhaltenen Zähne jedoch immer besser aus als die Implantatlösungen. Bei der Entscheidung für Zahnerhalt oder Implantat müssen verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Wichtig in ihrem Konzept ist der „Circle of Life“, der auch die Lebensphase des Patienten, der Patientin berücksichtigt. Falle die Entscheidung für ein Implantat, dann sei der Wunsch der Patienten meist: es soll nicht zu teuer sein, schnell gehen und ohne Schmerzen. „Der Patient will Sofortimplantation – geht dahin!“, so Hürzelers Rat. Wenn man Zeit investiert und lernt, werde man auch besser: „Wir müssen gewillt sein, aus der Komfortzone rauszugehen und neue Wege zu gehen“.
Intensive Diskussionsrunden
Besonders geschätzt wurden von den Referenten ebenso wie von den Teilnehmern die kompetenten und intensiven Diskussionsrunden zu den Themenblöcken. Die Fragen konnten über ein digitales Tool gestellt werden – Derk Siebers und seine Co-Moderatorinnen Dr. Maria Bruhnke, Prof. Dr. Tabea Flügge, Dr. Friederike Wendisch, Dörte Ort und Dr. Jana Hüsch gelang es dabei immer wieder, den Referenten in den Diskussionen besondere Statements zu entlocken und wichtige Themen zu vertiefen.
Save the date: 40. Berliner Zahnärztetag 2026
Der nächste Berliner Zahnärztetag wird ein Jubiläumskongress: Am 13. und 14. März 2026 heißt es zum 40. Berliner Zahnärztetag „Zahnmedizin im Wandel – Impulse, Innovationen und interdisziplinäre Perspektiven für eine gesunde Zukunft“. Dr. Derk Siebers und Dr. Holger Janssen werden dazu nicht nur für die Berliner Zahnärztinnen und Zahnärzte ein interessantes und überraschendes Programm präsentieren. Für Programmdetails und zur Anmeldung hier entlang.
Dr. Marion Marschall, Sonja Heinzen, Berlin