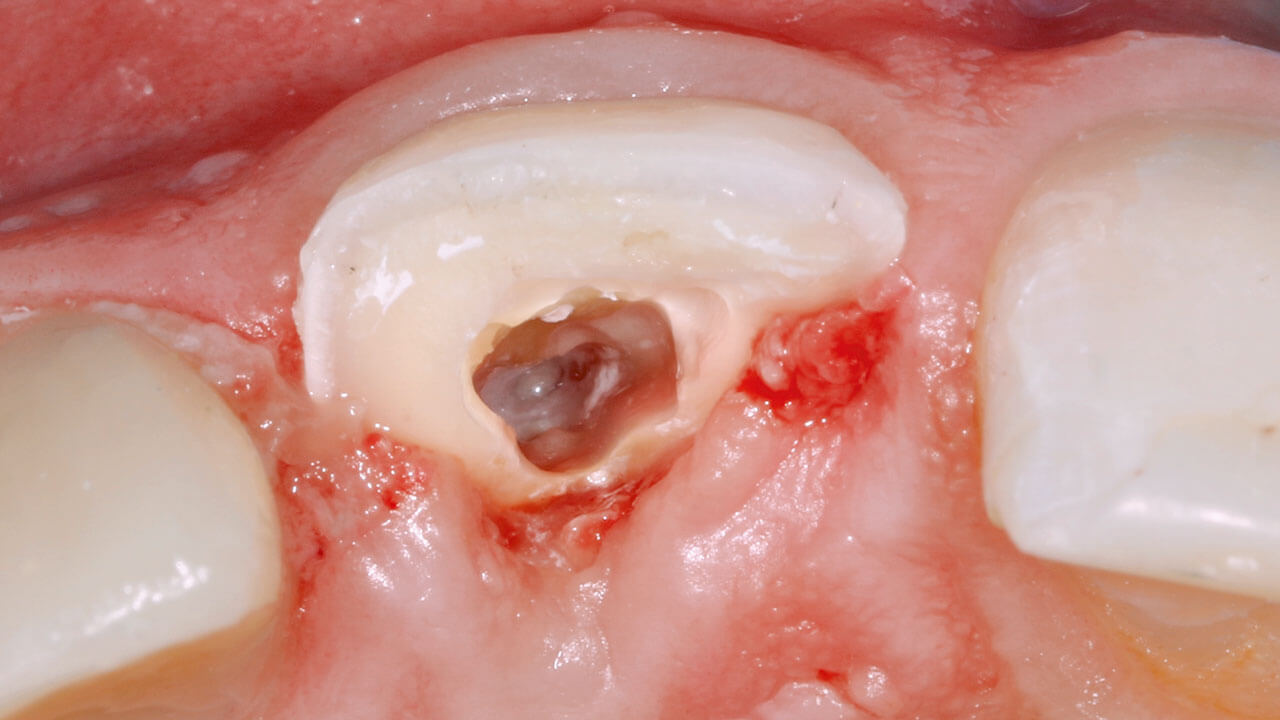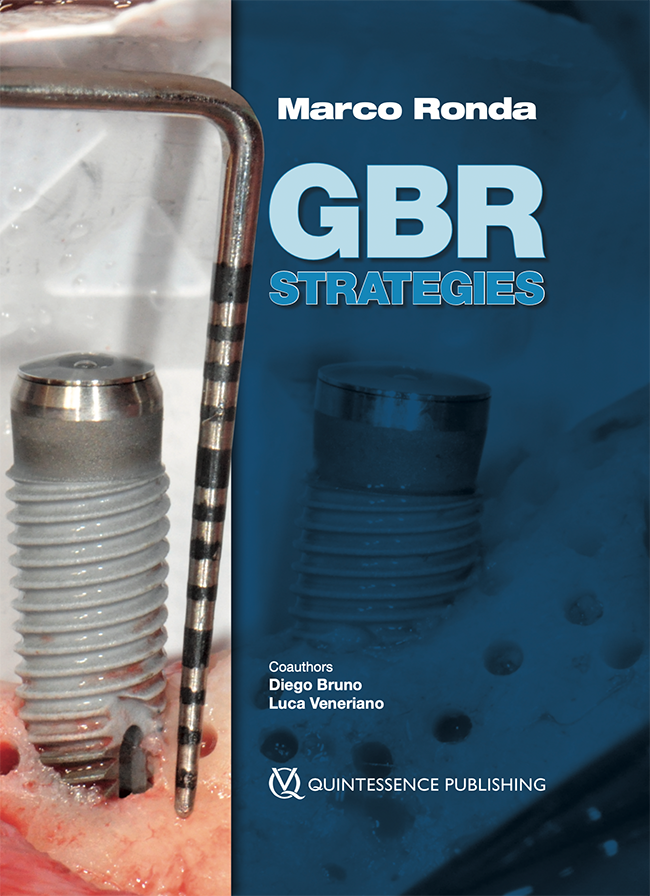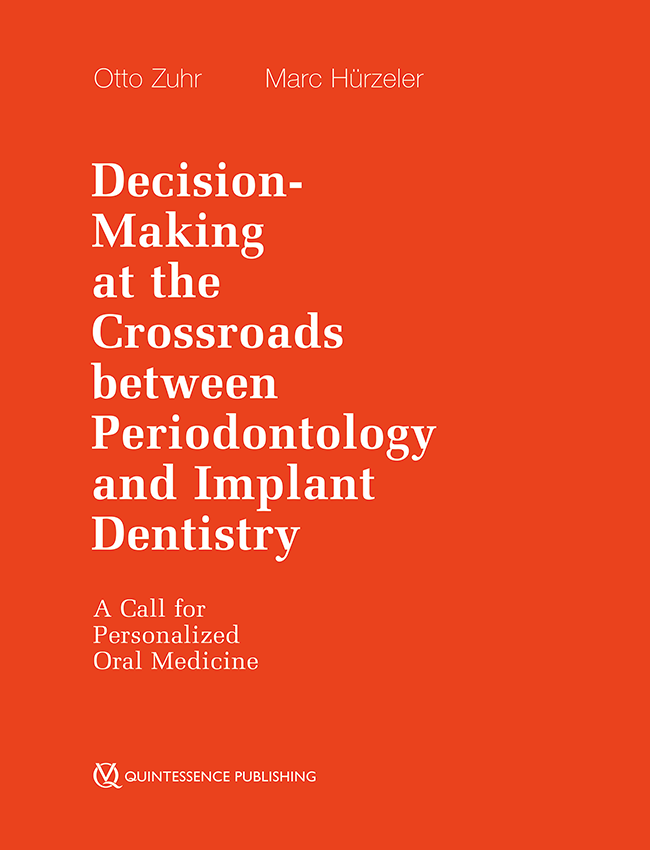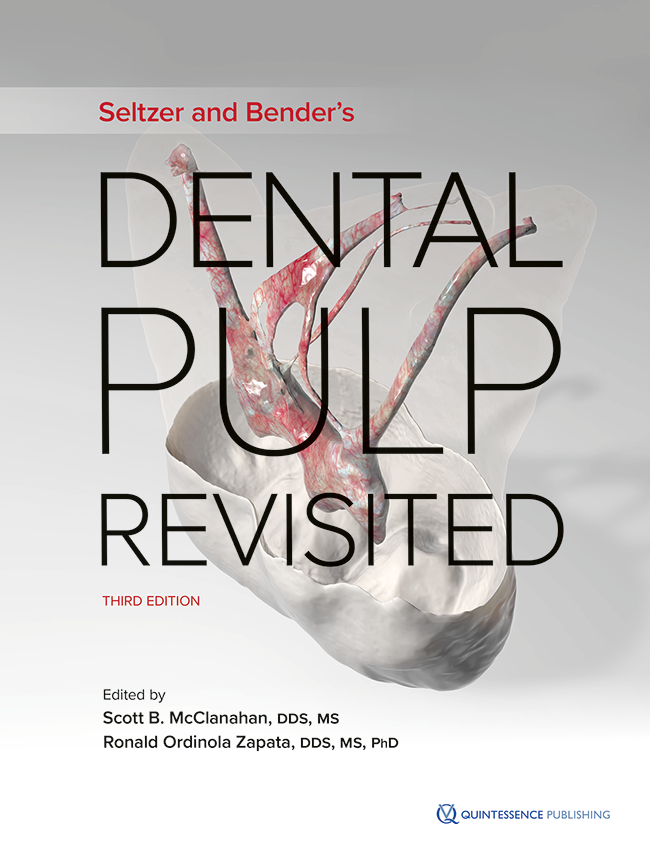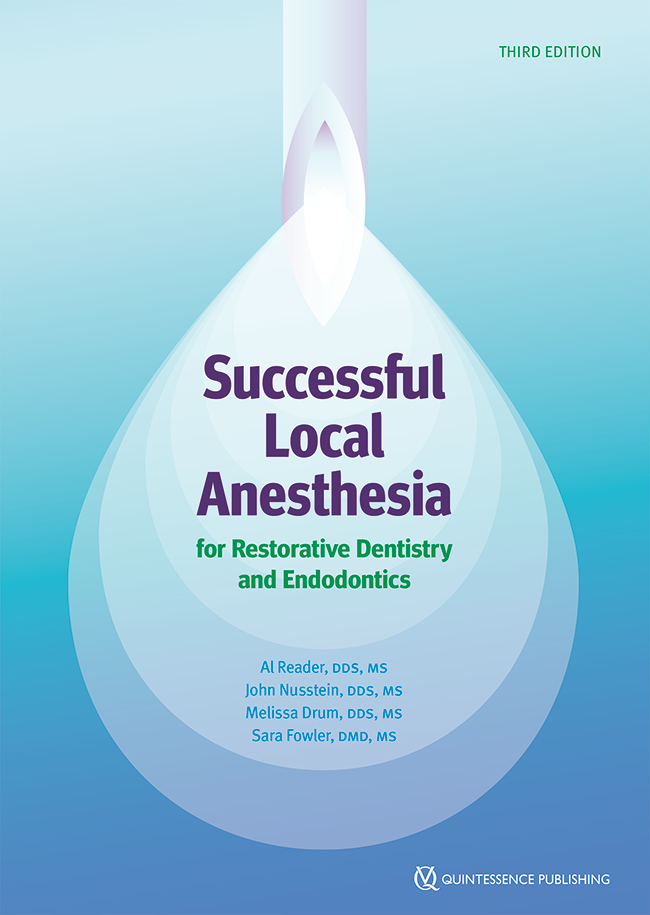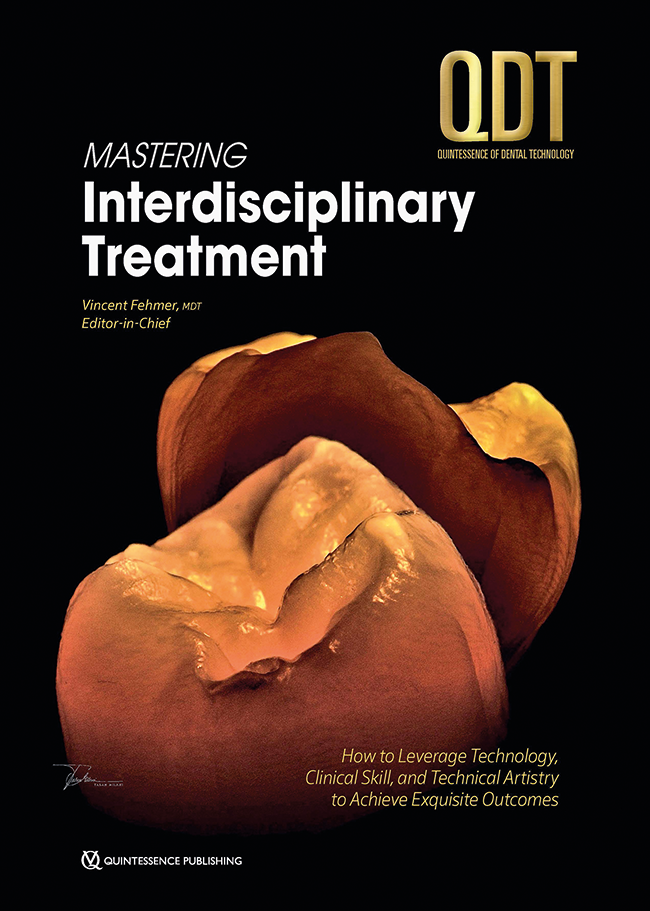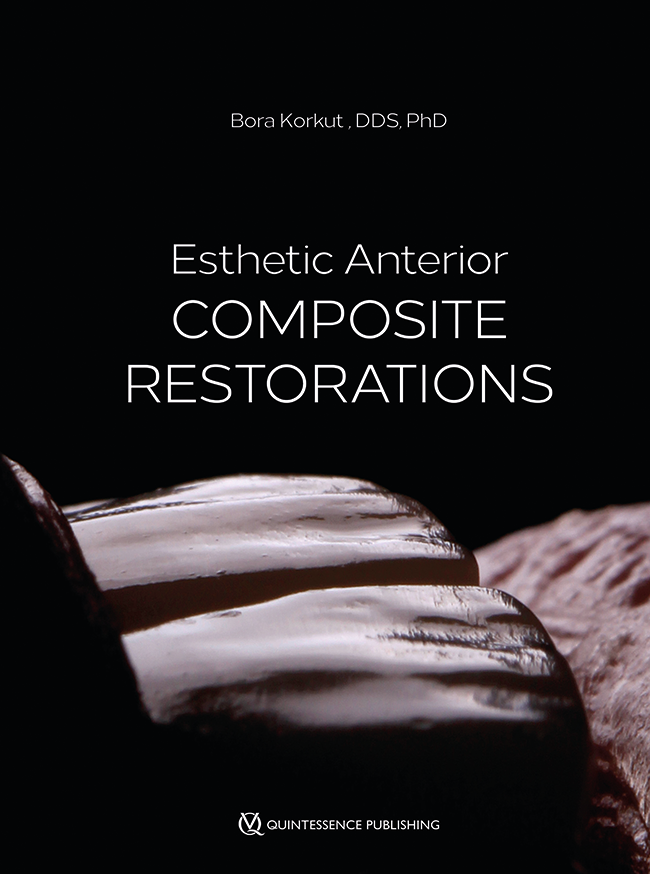Bild: privat
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Halling ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie-Plastische Operationen (MKG) und Zahnarzt für Oralchirurgie. Er absolvierte nach dem Studium der Zahnmedizin und der Humanmedizin in Marburg von 1985 bis 1992 seine Facharztweiterbildung am Bundeswehrkrankenhaus Hamburg sowie an der Universitätsklinik Göttingen.
1993 eröffnete PD Dr. Halling gemeinsam mit seiner Frau Dr. Sigrid Halling eine Facharztpraxis für MKG in Fulda. Der MKG-Experte leitete ab 1994 die Belegabteilung für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Plastische Operationen am Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda. 2015 wurde die Praxis als akademische Lehrpraxis der Universität Marburg akkreditiert. Im Jahr 2019 habilitierte sich PD Dr. Halling in Marburg für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit veröffentlichte er eine Vielzahl von internationalen wissenschaftlichen Publikationen und Buchbeiträgen. Weiterhin hat er mehr als 300 Vorträge und Seminare durchgeführt und lehrt seit mehr als fünfzehn Jahren an der Universität Marburg. Nach der Praxisübergabe ist er jetzt als Lehrbeauftragter in der Abteilung für MKG-Chirurgie an der Universität Marburg tätig. In einem Interview im Auftrag des Unternehmens Septodont beleuchtet PD Dr. Halling die zahnärztliche Lokalanästhesie und was bei der Auswahl, den Risiken und bei den Patientinnen und Patienten zu beachten ist.
? Welche Patientinnen und Patienten sind Ihrer Erfahrung nach die wichtigsten Risikogruppen im Rahmen der Lokalanästhesie und warum?
PD Dr. Frank Halling: Den klassischen Risikopatienten in der Lokalanästhesie gibt es in diesem Sinne nicht, es sind eher bestimmte Patientengruppen. Im Fokus stehen hier ältere Menschen mit Herzproblemen wie beispielsweise die koronare Herzkrankheit (KHK), Rhythmusstörungen oder Bluthochdruck. Der Adrenalinzusatz, der in den meisten Lokalanästhetika enthalten ist, führt immer zu einer Herzbelastung, der Puls und der Blutdruck steigen gleichzeitig an. Das kennt man auch von Stresssituationen. Für gesunde Menschen ohne Herzprobleme ist das im Allgemeinen kein Problem. Bei kardial vorbelasteten Patienten, die beispielsweise unter einer Herzinsuffizienz leiden, kann es bei der Anwendung adrenalinhaltiger Lokalanästhetika in Kombination mit einer durch Stress oder Schmerzen erhöhten endogenen Adrenalinausschüttung zu einem massiven Blutdruckanstieg kommen (hypertensive Krise). Bei Blutdruckwerten von mehr als 180/120 mmHg ist dann keine Behandlung mehr möglich. Hypertoniker neigen zu abrupten Blutdrucksteigerungen, wenn in kurzer Zeit größere Mengen Adrenalin verabreicht werden. Auch andere adrenalinhaltige Präparate, wie etwa Retraktionsfäden, sollten bei Hypertonikern nicht zur Blutstillung verwendet werden. Liegt eine schwere Rhythmusstörung vor, müssen adrenalinfreie Lokalanästhetika verwendet werden, um Tachykardien (Herzrasen) zu vermeiden und damit die potenzielle Gefahr einer Verschlechterung der Herzleistung durch Kammerflattern oder Kammerflimmern zu minimieren.
Für die Anwendung von Lokalanästhetika mit Adrenalin bei kardialen Risikopatienten sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Minimale Dosierung: Es sollte nur die geringstmögliche Menge an Adrenalin verwendet werden, die für eine ausreichende Betäubung erforderlich ist. Insbesondere bei Patienten mit KHK sollte die Adrenalindosis 0,035 mg nicht überschreiten
- Modifikation des Adrenalinzusatzes: In bestimmten Behandlungssituationen (beispielsweise Füllungstherapie) ist es durchaus möglich, auch Lokalanästhetika ohne Adrenalinzusatz zu verwenden.
- Sorgfältige Überwachung: Patienten mit kardialen Problemen sollten während und nach der Lokalanästhesie sorgfältig überwacht werden, um mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen.
? Kann man sagen, dass durch die alternde Gesellschaft der Zahnerhalt immer besser wird, deshalb die Menschen auch länger in die Praxis kommen und sich die Fälle mit Risiken dadurch häufen können?
Halling: Es gibt aktuelle Daten der Barmer-Krankenkasse, dass die Adhärenz von Patienten in der Zahnarztpraxis bis ins hohe Alter reicht [1]. Selbst im Alter von 75 Jahren stellen sich die Menschen in Deutschland zu 70 bis 80 Prozent noch einmal im Jahr in der Zahnarztpraxis vor. Außer bei den Hausärzten gibt es das bei keiner anderen Facharztgruppe. Das Recall-System zur Erinnerung an regelmäßige Zahnreinigungen fördert die Praxisbindung zusätzlich und erhöht die Chance für einen langen Erhalt der eigenen Zähne. Allerdings leidet knapp die Hälfte dieser Patientengruppe (70 Jahre und älter) laut FORSA-Umfrage von 2021 an mindestens drei behandlungsbedürftigen Krankheiten [2].
? Gibt es weitere Patientengruppen, die ein erhöhtes Risiko bei der Gabe von Lokalanästhetika haben?
Halling: Patienten mit einer erhöhten Medikamenteneinnahme weisen ein erhöhtes Behandlungsrisiko auf. Wegweisend war hier eine große Studie aus 1997 von Prof. Daubländer (Mainz) [3]. Sie hat mögliche Nebenwirkungen der Lokalanästhesie wissenschaftlich umfangreich aufgearbeitet. Demnach zeigen Patienten, die mehr als zwei Medikamente regelmäßig einnehmen, im Falle eines niedrigen Adrenalinzusatzes im Lokalanästhetikum (1:200.000) in etwa drei Prozent der Fälle und bei höherem Adrenalinzusatz (1:100.000) sogar in etwa sechs Prozent der Fälle irgendeine Art von Anästhesie-Komplikation. In der Studie wurden Patientengruppen mit höherer Dauermedikation, mit Lebererkrankungen oder Allergien genauer angesehen.
Eine weitere Risikogruppe sind Patienten mit einem metabolischen Syndrom, einer Kombination aus Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus und Hypertonie. Schwangere werden ebenfalls oft genannt. Sie und das ungeborene Kind werden aber bei einer schonenden Behandlung mit einem reduzierten Adrenalinzusatz (1:200.000 oder 1:400.000) keinen größeren Risiken ausgesetzt. Allerdings sind viele schwangere Frauen sehr ängstlich und stellen viele Fragen. Darauf sollte man rücksichtsvoll und kompetent eingehen.
Probleme können auch Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen entwickeln. Menschen mit Hyperthyreose können sensibler auf Adrenalin reagieren. Liegt eine Dysregulation oder Überfunktion vor, kann es deutlich schneller zu einer Blutdruck- oder Pulssteigerung als bei Gesunden kommen. Liegt gleichzeitig eine Herzerkrankung vor, wird dieser Effekt verstärkt, so dass sich daraus auch eine Notfallsituation ergeben kann.
? Von den meisten Erkrankungen wissen die Patienten, aber wie ist es bei Patienten mit unerkanntem Glaukom. Gibt es Anzeichen, die zeigen, dass eventuell eine solche Erkrankung vorliegt?
Halling: Es ist immer ein Problem, wenn ein Patient seine Krankheiten nicht kennt oder nicht darüber berichtet. Normalerweise füllt jeder neue Patient einen Anamnesebogen aus und wird dann auch noch einmal mündlich befragt. Gerade bei älteren Patienten sollte man sich nicht nur auf den Anamnesebogen verlassen, denn er wird oft nur sehr oberflächlich und manchmal sogar inkorrekt ausgefüllt. Deshalb halte ich eine zusätzliche mündliche Befragung für sehr wichtig. Es kostet vielleicht mehr Zeit und ist aufwendiger, dient aber der Behandlungssicherheit.
Zum Beispiel Glaukom-Patienten: das sind Patienten mit erhöhtem Augeninnendruck. Die Wahrscheinlichkeit, ein Glaukom zu entwickeln, steigt mit dem Lebensalter. Ab dem 40. Lebensjahr sind etwa zwei Prozent der Bevölkerung betroffen. Die Erkrankung wird meist im Rahmen augenärztlicher Untersuchungen diagnostiziert. Diese Patienten sollten zwingend nur mit einem reduzierten Adrenalinzusatz oder adrenalinfrei behandelt werden. Es kann zu Komplikationen kommen, wenn durch den Vasokonstriktor Adrenalin der Augeninnendruck ansteigt und damit eine akute Abflussbehinderung des Kammerwassers (Glaukomanfall) mit möglichem Sehverlust ausgelöst wird. Bei einem akuten Glaukomanfall würde der Patient relativ schnell starke Schmerzen im Augapfel bekommen. Dies ist ein ophthalmologischer Notfall, wobei initial die medikamentöse Senkung des Augeninnendrucks im Vordergrund steht. Der Patient muss dann sofort in die Augenklinik.
? Als Mediziner erkennen Sie Frühzeichen einer Allgemeinerkrankung vielleicht auch dann, wenn Patientin oder Patient dazu keine Angabe in der Anamnese gemacht haben. Gibt es besondere Anzeichen für zahnmedizinisch relevante Erkrankungen, auf die Ihre KollegInnen in diesem Zusammenhang achten sollten?
Halling: Es gib fünf Beispiele von medizinischen Anzeichen:
- Beim ersten Beispiel sind wir wieder beim Auge, der Exophthalmus ist ein typisches Zeichen eines Morbus Basedow. Diese Autoimmunthyreopathie führt zu einer Hyperthyreose und ist mit der klassischen Trias aus Struma, Exophthalmus und Tachykardie vergesellschaftet. Wenn der Bulbus des Auges aus der Augenhöhle (Orbita) hervortritt und gleichzeitig eine erweiterte Lidspalte vorliegt, muss man davon ausgehen, dass der Patient eine Schilddrüsenstörung hat und wesentlich empfindlicher auf Adrenalin reagiert. Diese Augenveränderung sieht man schon, bevor der Patient etwas sagen muss. Frauen sind fünf- bis achtmal häufiger betroffen als Männer.
- Zweites Beispiel sind Patienten mit einer obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Sie kommen manchmal mit einer „mobilen“ Sauerstoffflasche und entsprechenden Schläuchen in der Nase in die Praxis. Dann ist klar, dass so ein Patient wenig belastbar ist und Probleme mit dessen Lungenfunktion auftreten können. Man sollte eher kurze Termine machen und den Patienten nicht zu flach positionieren, um ihm die Atmung zu erleichtern. Es sollte auch auf die Tagesform des Patienten Rücksicht genommen werden. Wenn es dem Patienten nicht gut geht, verschiebt man die Behandlung besser. Mittlerweile sind obstruktive Lungenerkrankungen als Folge von langjährigem Tabakkonsum sehr häufig.
- Drittes Beispiel sind die typischen klinischen Anzeichen für Leberentzündungen (akute und chronische Hepatitis) wie gelbliche Verfärbung der Bindehaut, einen Sklerenikterus. Eine glatte Lackzunge, die durch eine Atrophie der Zungenpapillen gekennzeichnet ist, weist zusätzlich auf eine Leberzirrhose hin. Die Lackzunge ist oft von Zungenbrennen begleitet. Ein drittes Symptom sind Gefäßveränderungen in Form von Spider naevi, also kleinen Gefäßerweiterungen im Gesicht und auch an der gesamten Hautoberfläche. Das sind drei typische Zeichen für eine chronische Hepatitis mit Leberzirrhose. Hier ist zu beachten, dass das Lokalanästhetikum durch die Leberschädigung langsamer abgebaut wird. Bei einer Leberzirrhose muss mit einer verminderten Produktion von Gerinnungsfaktoren gerechnet werden, so dass daraus eine erhöhte Blutungsneigung resultieren kann.
- Viertes Beispiel ist eine Kombination aus blasser Haut, Mundwinkelrhagaden (offene Mundwinkel) und einer Zungenentzündung mit Zungenbrennen sowie Schluckstörungen (Dysphagie) – das sind typische Zeichen einer Eisenmangelanämie. Darunter leiden relativ viele ältere Menschen. Viele wissen nicht, woher ihre Symptome kommen und behandeln diese Stellen mit Salben etc., ohne wirklichen Effekt. Bei diesen Patienten muss mit einer schlechteren Wundheilung gerechnet werden.
- Fünftes und letztes Beispiel ist das Von-Willebrand-Syndrom (VWS). Im Mund- und Gesichtsbereich können Symptome auftreten, die auf eine gestörte Blutgerinnung hinweisen wie verstärktes Zahnfleischbluten, Nasenbluten und Blutungen aus kleinen Wunden im Mund oder an der Lippe.
In Kursen empfehle ich den Kolleginnen und Kollegen, dass sie den Patienten sehen sollten, wenn er den Behandlungsraum betritt, nicht erst, wenn er schon im Stuhl sitzt. Hintergrund ist, dass dann auch Symptome von Krankheiten wie Morbus Parkinson (Gangunsicherheit, gebückte Haltung etc.) viel schneller erkannt werden können.
? Was ist bei multimorbiden Patienten zu beachten?
Halling: Hier ist vorab zu klären, was Multimorbidität ist – in der Literatur ist das nicht einheitlich. Die meisten Veröffentlichungen sprechen von drei oder mehr chronischen Erkrankungen [4], die dauerhaft therapiert werden. Gekoppelt daran ist der Begriff Polypharmazie oder Polypharmakotherapie. Das bedeutet, dass ein Mensch fünf oder mehr Medikamente regelmäßig einnimmt [5]. Zahlen dazu gibt es vom Wissenschaftlichen Institut der AOK [6]. Mehr als 40 Prozent der Menschen ab 65 Jahren in Deutschland leiden an drei oder mehr chronischen Krankheiten [6]. Sie sind also multimorbide. Bei den 70-Jährigen sind es sogar knapp 50 Prozent [2]. Etwa 42 Prozent der Menschen ab 65 nehmen bereits fünf und mehr Medikamente [6] und fallen damit unter den Begriff Polypharmazie.
Ich halte es generell für wichtig zu wissen, welche Krankheiten in der Bevölkerung wie häufig auftreten. In Leipzig hat Prof. Dr. Gerhard Schmalz (Anmerkung der Red.: jetzt: Medizinische Hochschule Brandenburg) in zahnmedizinischen Studentenkursen knapp 900 Patienten befragt, welche Krankheiten bei ihnen vorliegen. Es litten 31,6 Prozent der Patienten an Hypertonie, 29,5 Prozent hatten Allergien, 14,7 Prozent litten an Schilddrüsenerkrankungen. Bei 7,4 Prozent lag ein Diabetes mellitus vor und 7,1 Prozent litten an Asthma. Kardiale Arrhythmien gelten als relativ schwere Krankheiten mit manchmal tödlichen Komplikationen. In dieser Studie lag die Häufigkeit bei knapp 5 Prozent der Teilnehmer [7].
Die Zahnmediziner müssen auf diese Krankheitsbilder bei ihren – oft älteren – Patienten vorbereitet sein. Dieser Aspekt wird auch für die zahnmedizinisch-klinische Forschung in Zukunft immer wichtiger werden. Die Überalterung der Gesellschaft betrifft in den nächsten Jahrzehnten alle Zahnarztpraxen. Die jetzt 60- bis 65-jährigen Babyboomer sind in zehn Jahren Mitte 70. Infolgedessen wird die Generation der Zahnärzte, die jetzt neu in die Praxen kommen, mit dieser Patientengruppe und ihren spezifischen Krankheiten und Anforderungen an die zahnärztliche Behandlung in zunehmendem Ausmaß konfrontiert werden.
Aus der Geriatrie kennen wir Methoden, diese Patientengruppe einfach und effektiv bezüglich der Behandlungsplanung zu kategorisieren. Dazu werden drei Kategorien gebildet: „Go go, „slow go“ und „no go“. „Go go“ ist der ältere Patient, der gesund ist und dem grundsätzlich alle Varianten der Therapie angeboten werden können. „Slow-Go“ ist der Patient, der vielleicht aufgrund körperlicher Einschränkungen schon betreut wird, aber noch geistig fit ist. Die „no go“-Gruppe sind Menschen, die bettlägerig sind und beispielsweise im Heim untergebracht sind. Sie können nicht mehr in die Praxen kommen und sind dauerhaft auf Hilfe angewiesen, zum Teil auch dement. Hier sind nur die allernotwendigsten und möglichst minimal-invasiven Therapien indiziert.
In Bezug auf die Gabe von Lokalanästhetika ist bei den multimorbiden Patienten zu beachten, dass „dosiert und differenziert“ vorgegangen wird. Somit sollte die Behandlung möglich in kleinere Schritte eingeteilt werden. Es gibt natürlich auch ältere Patienten, die alles in einem Termin erledigt haben wollen, aber das funktioniert bei multimorbiden Patienten in der Regel nicht. Hier sind kleinere, weniger belastende Behandlungsschritte auf jeden Fall besser.

Bild: Septodont
? Warum ist es bei der Gabe von Lokalanästhetika wichtig zu wissen, welche anderen Wirkstoffe die Patientin oder der Patient regelmäßig einnimmt?
Halling: Ich beschäftige mich schon länger wissenschaftlich mit lokalen Anästhetika und habe vor einigen Jahren eine Verbrauchsstudie zu Lokalanästhetika in Deutschland und international publiziert [8]. Dabei wurde untersucht, welche Mengen und welche Art von Lokalanästhetika in Deutschland und international von den Zahnärzten verbraucht werden. Eines der Hauptprobleme in Deutschland ist der sehr hohe Anteil von Lokalanästhetika-Zubereitungen mit dem höchsten Adrenalinzusatz, also 1:100.000. In allen anderen Ländern, zu denen Daten existieren, liegt der Anteil der Lokalanästhetika mit sehr hohem Adrenalinanteil niedriger. Der Vorteil der hohen Adrenalinkonzentration ist sicherlich eine gute Betäubung mit wenig Blutung, da sich die Blutgefäße stark zusammenziehen. Allerdings ist der hochdosierte Adrenalinzusatz gleichzeitig mit einer wesentlich stärkeren Ausprägung der typischen Nebenwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, wie Herzrasen (Tachykardie), erhöhtem Blutdruck und möglichen Herzrhythmusstörungen verbunden. Auch Wirkungen auf das zentrale Nervensystem, wie Angstzustände, Nervosität, Unruhe, Schwindel oder Kopfschmerzen sind möglich. Meine Empfehlung ist: Bei kleineren Eingriffen, bei Risikopatienten, bei älteren Patienten oder Kindern eine adrenalinreduzierte oder adrenalinfreie Lokalanästhesie verwenden!
Die Industrie offeriert ein breites Angebot an Lokalanästhetika mit geringeren Mengen oder ganz ohne Adrenalin. Viele Zahnärzte bevorraten ungern verschiedene Lokalanästhetika-Zubereitungen. Doch aus medizinischer Sicht sollte eine moderne Praxis mit Schwerpunkt auf eine individuelle, patientenorientierte Zahnmedizin eine Mindestzahl von verschiedenen Anästhetika-Zubereitungen vorhalten. So ist man für jede Behandlungssituation vorbereitet. Allgemeinmedizinische Komplikationen entstehen fast immer wegen des Adrenalinzusatzes, Articain selbst macht fast nie Probleme.
Im Zusammenhang mit einer Leitungsanästhesie sind bestimmte Medikamente problematisch, vor allem Blutverdünner. Wird bei einer Leitungsanästhesie im Unterkiefer ein Blutgefäß getroffen, was häufiger passiert, kann es zu einer massiven Gewebeeinblutung kommen, ohne dass es der Behandler oder der Patient sofort merken. Nach kurzer Zeit kommt es zu einer Behinderung der Mundöffnung oder auch zu Problemen mit der Atmung. Als Konsequenz sollte man bei Patienten, die Blutverdünner einnehmen, auf andere Spritzentechniken wie Infiltrationsanästhesie oder die intraligamentäre Anästhesie zurückgreifen. Leider erhielten laut Jahrbuch der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung von 2024 in Deutschland von je 100 Patienten einer Zahnarztpraxis immer noch etwa 16 eine Leitungsanästhesie [9]! Es geht darum, die Zahl der Leitungsanästhesien aufgrund ihres relativ hohen Komplikationspotenzials in Zukunft deutlich zu reduzieren.
Eine weitere Gruppe mit Problempotenzial sind Digitalispräparate, die bei der Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Herzglykoside steigern die Kontraktilität des Myokards, wodurch die Herzfrequenz kompensatorisch heruntergeregelt werden kann, um ein konstantes Herzzeitvolumen zu erhalten. Adrenalin wirkt diesem Mechanismus entgegen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Digitalis und Adrenalin können Herzrhythmusstörungen auftreten, da Digitalispräparate die Empfindlichkeit des Herzmuskels für Adrenalin erhöhen. Somit ist bei Patienten, die Digitalis einnehmen, bei Lokalanästhetika mit Adrenalin größte Vorsicht geboten.
Unselektive Betablocker wie Propanolol werden heute nur noch selten verordnet. Sollte dies doch der Fall sein, besteht bei der Gabe von adrenalinhaltigen Lokalanästhetika die Gefahr einer hypertonen Reaktion des Herzens (Hochdruckkrise) oder einer reaktiven Bradykardie.
Eine weitere Gruppe sind Präparate, die in den körpereigenen Abbau von Adrenalin eingreifen. Solche werden hauptsächlich in der Psychiatrie verwendet und verzögern die Metabolisierung von Articain. Diese Wirkung zeigt die Gruppe der Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer), die unter anderem bei Depressionen eingesetzt werden. Sie hemmen den Abbau von Adrenalin. Ähnliche Effekte zeigen sich bei den trizyklischen Antidepressiva, beispielsweise Amitriptylin. Sie hemmen die Wiederaufnahme von Adrenalin und Noradrenalin in den Nervenzellen. Diese Mittel sind sehr verbreitet und werden von relativ vielen Menschen eingenommen. Demzufolge muss jeder Zahnarzt auf Präparate achten, die in den Abbau von Adrenalin eingreifen und diesen Abbau hemmen.

Bild: Septodont
? Was ist das Besondere an Articain als Wirkstoff in der Lokalanästhesie?
Halling: Articain ist insofern besonders, da es gleichzeitig eine Ester- und eine Amidgruppe aufweist. Die Anästhetika auf Esterbasis hat man Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt. Diese haben sehr schnell gewirkt, hatten allerdings den Nachteil, dass sie schnell wieder abgebaut wurden und dazu noch relativ viele Nebenwirkungen auslösten. Mit Lidocain kam 1942 erstmals ein gut wirksames und nebenwirkungsarmes Säureamid auf den Markt. Anfang der 70er Jahre hat man dann in Deutschland bei Höchst das Articain entwickelt. Da es aus einer Ester- und einer Amidgruppe besteht, vereint es die Vorteile beider Gruppen. Eine wesentliche, günstige Eigenschaft von Articain gegenüber den anderen Säureamiden ist der relativ schnelle Abbau. Die normale Halbwertzeit liegt bei etwa 20 Minuten. Der Grund liegt darin, dass etwa 85 bis 90 Prozent des applizierten Articains nicht in der Leber abgebaut werden, sondern im Blut. Das liegt an einem bestimmten Enzym, der Pseudocholinesterase. Dieses Enzym hat den „Vorteil“, dass es sowohl bei jungen wie auch alten Menschen etwa in gleicher Menge im Blut vorkommt. Das bedeutet, dass man Articain auch bei älteren Patienten ohne größere Risiken verabreichen kann, weil es genauso schnell abgebaut wird wie bei jungen Patienten. Das wurde 1999 in einer Studie von Oertel und Mitarbeitern eindrucksvoll nachgewiesen [10]. Anderen Amid-Lokalanästhetika weisen deutlich längere Eliminationszeiten auf.
? Welche Nebenwirkungen können bei einer Lokalanästhesie auftreten?
Halling: Nebenwirkungen werden eingeteilt in lokale und systemische Komplikationen. Lokale Komplikationen wie Blutungen oder Hämatome treten häufiger auf, zum Beispiel, wenn man bei einer Leitungsanästhesie auf ein Blutgefäß trifft. Prinzipiell kann man sagen: Je näher man am Zahn betäubt, desto geringer ist das Risiko für Blutungskomplikationen. Eine weitere lokale Komplikation kann der Nadelbruch sein. Bei der heutigen Qualität der Herstellungsprozesse dürfte dieses Problem der Vergangenheit angehören. In meiner 30-jährigen Praxis habe ich nicht einmal erlebt, dass eine Nadel abgebrochen ist.
Selten, aber gefürchtet sind sogenannte Spritzenabszesse. Sie treten als Komplikation einer Injektion auf. In der Zahnmedizin handelt es sich praktisch immer um Infektionen durch das Eintragen von Bakterien ins Gewebe nach einer Leitungsanästhesie. Typischerweise entwickelt sich innerhalb der ersten 24 Stunden eine Kieferklemme. Wir lassen die Patienten vor allen invasiven Eingriffen mit Chlorhexidin spülen. Nach einer Minute Spülung ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch eine Injektion Keime verschleppt, bereits sehr viel geringer.
Eine häufige Frage ist, ob durch die Lokalanästhesie Nervschädigungen entstehen können. Nach Literaturangaben wird die Inzidenz einer Parästhesie nach der Leitungsanästhesie des Nervus alveolaris inferior mit 0,15 bis 0,54 Prozent für eine temporäre und mit 0,00001 bis 0,01 Prozent für eine dauerhafte Beeinträchtigung angegeben [11]. Dadurch ist erkennbar, dass bleibende Nervschäden äußerst unwahrscheinlich sind.
Eine weitere lokale Komplikation kann eine Selbstverletzung sein: wenn die Spritzenwirkung über eine längere Zeit anhält, die Patienten also zu lange oder zu intensiv betäubt bleiben, besteht Gefahr, dass sie sich unbewusst auf Lippen oder Zunge beißen. Dies kann besonders bei Kindern oder bei dementen Patienten passieren. Auch Patienten, die Blutverdünner einnehmen, sind gefährdet, da es dann manchmal zu massiven Blutungen aus der Lippe oder Zunge kommen kann. Im Idealfall sollten die Patienten wieder ohne eine Betäubung sein, wenn sie aus der Praxis gehen.
Zu den systemischen Komplikationen zählt die Ohnmacht. Häufig tritt diese Komplikation bei Menschen auf, die sehr agitiert oder sehr ängstlich sind. Hier ist fraglich, ob die Ursache der Ohnmacht die Angst vor der Behandlung oder die Spritze der Grund ist. Das ist oft schwer zu differenzieren. Wie ängstlich ein Patient ist, lässt sich im Vorgespräch herausfinden. Im Rahmen einer geplanten Operation werden unter anderem eine Vorbesprechung sowie eine Operations-Aufklärung gemacht. Danach kann man den Patienten und seine Angst in der Regel gut einschätzen. Bei ängstlichen Patienten sollte bei Bedarf auch eine zusätzliche orale Sedierung angeboten werden. Dann darf der Patient nicht ohne Begleitung die Praxis verlassen.
Auch die Intoxikation durch Überdosierung kann eine systemische Komplikation sein. Das ist allerdings äußerst selten. Es passiert dann, wenn innerhalb kurzer Zeit sehr viel gespritzt und dabei ein Blutgefäß getroffen wird, also die Lokalanästhesie versehentlich intravasal appliziert wird. Als Folge kann eine Kreislaufreaktion mit massiven kardialen Problemen ausgelöst werden.
? Sie haben aktuell einen Reviewartikel veröffentlicht, der sich mit dem Thema „Echte Allergien auf den Wirkstoff Articain“ beschäftigt. Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Halling: Wir haben uns mit Patienten schwergetan, die angaben, sie hätten eine Allergie auf „Betäubungsspritzen“, also auf Lokalanästhetika. Das wird vor allem in den vergangenen fünf Jahren immer mehr. Nicht immer stecken echte Allergien dahinter. Fast immer liegt weder ein Allergieausweis vor noch existieren andere Nachweise allergologischer Tests. Oft hört man dann auch, dass die Allergie nie ärztlich untersucht wurde. Bei den Lokalanästhetika ist das ein Problem, da viele Präparate Strukturähnlichkeiten aufweisen. Andererseits möchte natürlich kein Behandler einen allergischen Notfall in seiner Praxis haben. Das hat uns veranlasst, uns mit potenziellen Allergien auf Articain näher zu beschäftigen. Schließlich ist Articain in Europa der führende Lokalanästhetika-Wirkstoff. Unser Ziel war herauszufinden, wie viele Allergien in der Literatur tatsächlich nachgewiesen wurden. Wir haben eine Literaturrecherche der vergangenen 25 Jahre durchgeführt, um zu eruieren, in wieviel Fällen tatsächlich ein beweisender positiver Hauttest, beispielsweise beim Allergologen, vorgenommen und in einem wissenschaftlichen Artikel dokumentiert wurde [12].
Es gab in 25 Jahren weltweit insgesamt lediglich 16 Studien, in denen über Allergien auf Articain berichtet wurde. In diesen Studien wurden insgesamt 1.333 Personen getestet. Lediglich bei 29 Personen konnte eine Allergie auf Articain durch einen positiven Hauttest nachgewiesen werden. Überwiegend handelte es sich um Sofortallergien. Der Marktanteil von Articain auf dem deutschen Markt beträgt seit Jahren etwa 96 Prozent [8]. Bei schätzungsweise ca. 70 Millionen Spritzen, die in Deutschland im Rahmen der zahnärztlichen Lokalanästhesie pro Jahr appliziert werden [13], ist die Zahl von 29 Patienten weltweit mit nachgewiesener Allergie gegen diesen Wirkstoff praktisch irrelevant.
Für die Patienten mit ärztlich nachgewiesener Allergie gegen Articain gibt es zudem Alternativen. Die entsprechenden Wirkstoffe sollten bei einem Allergietest idealerweise gleich mitgetestet werden. Wenn Patienten in die Praxis kommen und eine vermutete Allergie gegen Lokalanästhetikum angeben, sollte im Falle einer elektiven Behandlung zunächst das Ergebnis eines fachgerecht durchgeführten Allergietests, beispielsweise bei einem Allergologen, abgewartet werden. Das ist natürlich nicht bei zahnmedizinischen Notfällen machbar. Unter diesen Umständen sollte nach entsprechender Aufklärung und Einwilligung des Patienten ein alternativer Wirkstoff wie Lidocain eingesetzt werden. Dieser sollte in der Praxis vorrätig sein.
? Worauf ist im Zusammenhang mit Zusatzstoffen in Lokalanästhetika zu achten?
Halling: Bei den Zusatzstoffen ist hauptsächlich das Antioxidans Natriummetabisulfit ein Problem. Der Zusatz von Sulfit hat chemische Gründe, denn das Adrenalin würde ansonsten mit dem Sauerstoff reagieren und wäre dann nicht mehr wirksam. In den Spritzen ist normalerweise lediglich 0,3 Milligramm Sulfit pro Milliliter enthalten. Asthma bronchiale ist eine relative Kontraindikation für Lokalanästhetika, denn bei bis zu 8,4 Prozent der Patienten mit ausgeprägtem Asthma kann Sulfit zu Reaktionen wie Asthmaanfällen oder Schock führen [14]. Generell sollte man bei ausgeprägtem Asthma versuchen, mit Spritzen ohne Adrenalinzusatz zu arbeiten, denn in diesen ist kein Sulfit enthalten.
Auch Methyl-4-hydroxybenzoat, das bei Mehrfachentnahmeflaschen als Konservierungsmittel beigefügt ist, kann Überempfindlichkeitsreaktionen und selten Bronchospasmen hervorrufen [11]. Allerdings werden die Mehrfachentnahmeflaschen eher seltener benutzt.
Zehn Punkte, worauf bei der Lokalanästhesie besonders zu achten ist
- Zunächst abklären, ob bisherige örtliche Betäubungen gut vertragen wurden.
- Nachfragen, ob kardiovaskuläre Erkrankungen oder Erkrankungen des zentralen Nervensystems vorliegen.
- Ausführlich über Risiken aufklären, insbesondere bei einer geplanten Leitungsanästhesie. Alles lückenlos und nachvollziehbar dokumentieren.
- Leitungsanästhesien aufgrund des ungünstigen Risikoprofils möglichst vermeiden. Adrenalinreduzierte oder adrenalinfreie Lokalanästhetika bevorzugen, da der Adrenalinzusatz die meisten Nebenwirkungen auslöst. Es gilt der Satz: So viel wie nötig und so wenig wie möglich injizieren.
- Bei Risikopatientinnen oder Patienten mit KHK, Epilepsie, Schwangere, mehreren Erkrankungen und bei Kindern Stress vermeiden und den Adrenalinzusatz auf das Mindestmaß begrenzen.
- Diabetiker nicht zu lange auf die Behandlung warten lassen. Längere Nahrungskarenz vor der Behandlung und manchmal auch nach der Behandlung kann zu einer potenziell lebensgefährlichen Hypoglykämie führen.
- Eine dosierte und langsame Injektion unter stetiger Aspiration schont die Patienten und gibt dem Behandler Sicherheit.
- Patienten nach einer Lokalanästhesie nie alleine lassen, damit ein potenzieller Notfall schnell erkannt und gegebenenfalls eingegriffen werden kann. Entweder es bleibt jemand im Behandlungsraum oder die Tür bleibt offen.
- Angstpatienten ohne besondere Risikofaktoren gegebenenfalls zusätzlich zur Lokalanästhesie oral sedieren. Der Patient muss die Praxis dann immer mit einer Begleitung verlassen.
- Zuletzt noch wichtig: In jede Zahnarztpraxis gehört eine funktionstüchtige Notfallausrüstung. Die Abläufe im Notfall sollten mit dem Team regelmäßig eingeübt werden.
Literatur
- BARMER. Pressemitteilung (18. Oktober 2021) Kein Corona-Effekt – Frauen nutzen Zahnmedizin häufiger als Männer. https://www.barmer.de/presse/presseinformationen/pressearchiv/zahnmedizin-frauen-maenner-1059432 , Zugriff Juli 2025.
- Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH (Erhebung 2021), DIE APOTHEKE – ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 2023, Herausgeber ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.
- Daubländer M, Müller R, Lipp MD. The incidence of complications associated with local anesthesia in dentistry. Anesth Prog. 1997 Fall;44(4):132-41. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2148940/pdf/anesthprog00236-0020.pdf , Zugriff Juli 2025.
- Seger W, Gärtner T. Multimorbidität – eine besondere Herausforderung. Dtsch Arztebl 117 (44) (2020): A 2092–2096. https://www.aerzteblatt.de/archiv/pdf/8b9383d6-e128-437e-bedf-7057a7031140 , Zugriff Juli 2025.
- Masnoon N, Shakib S, Kalisch-Ellett L, Caughey GE. What is polypharmacy? A systematic review of definitions. BMC Geriatr. 2017 Oct 10;17(1):230. doi: 10.1186/s12877-017-0621-2. https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-017-0621-2 , Zugriff Juli 2025.
- Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO). Pressemitteilung und Pressemappe (17. November 2022) „Qualität der Arzneimittelversorgung“ im Fokus des Arzneimittel-Kompass 2022 https://www.wido.de/news-presse/pressemitteilungen/2022/arzneimittel-kompass-2022 , Zugriff Juli 2025
- Schmalz G, Brauer L, Haak R, Ziebolz D. Evaluation of a concept to classify anamnesis-related risk of complications and oral diseases in patients attending the clinical course in dental education. BMC Oral Health. 2023 Aug 29;23(1):609. doi: 10.1186/s12903-023-03343-x. https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-023-03343-x , Zugriff Juli 2025.
- Halling F, Neff A, Ziebart T. Local Anesthetic Usage Among Dentists: German and International Data. Anesth Prog. 2021 Mar 1;68(1):19-25. doi: 10.2344/anpr-67-03-12. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8033583/pdf/i0003-3006-68-1-19.pdf , Zugriff Juli 2025.
- Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) (Hrsg.). Jahrbuch 2024. https://www.kzbv.de/wp-content/uploads/KZBV2024_Jahrbuch_WEB_ohne_GOZ.pdf , Zugriff Juli 2025.
- Oertel R, Ebert U, Rahn R, Kirch W. The effect of age on pharmacokinetics of the local anesthetic drug articaine. Reg Anesth Pain Med. 1999 Nov-Dec;24(6):524-8. doi: 10.1016/s1098-7339(99)90043-3 .
- Kämmerer P: Potenzielle Komplikationen bei der zahnärztlichen Lokalanästhesie. In: Schmerzkontrolle in der Zahnmedizin (Hrsg. P.W. Kämmerer und D. Heimes) Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin 2024.
- Halling F, Neff A, Meisgeier A. True allergies to articaine: a 25-year analysis. Dent J 13(5) (2025):180. doi: 10.3390/dj13050180. https://www.mdpi.com/2304-6767/13/5/180/pdf , Zugriff: Juli 2025.
- Daubländer M, Kämmerer PW, Lokalanästhesie in der Zahnmedizin, 2011, Berlin, Sanofi
- Heimes D, Kämmerer P: Anamnese und individualisierte Lokalanästhesie. In: Schmerzkontrolle in der Zahnmedizin (Hrsg. P.W. Kämmerer und D. Heimes) Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin 2024.