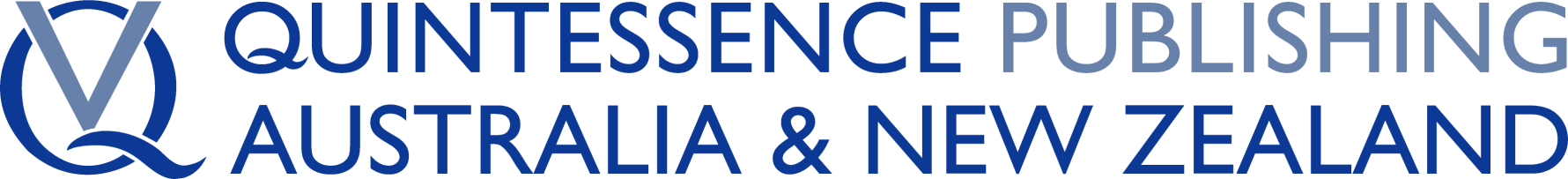Kieferorthopädie, 2/2025
WissenschaftSeiten: 121-137, Sprache: Deutsch, EnglischBerger, Lilian / Stawarczyk, Bogna / Keller, Alexander / Wichelhaus, Andrea / Hoffmann, LeaEin narrativer ReviewZiel: Vergleich der physikalischen und biologischen Eigenschaften von subtraktiv oder additiv hergestellten Schienen im Gegensatz zu konventionell hergestellten Schienen. Bei den additiv hergestellten Schienen werden ausschließlich Studien zu harzbasierten Systemen betrachtet. Methode: Die Studienrecherche wurde gemäß der PRISMA-Richtlinien durchgeführt, wobei eine elektronische Suche in der MEDLINE-Datenbank (via PubMed) vom 14.02.2025 bis 25.03.2025 erfolgte. Ergebnisse: Im Indikationsbereich für orale Schienen weisen subtraktiv hergestellte Schienen die höchsten mechanischen Eigenschaften auf, da sie eine größere Härte und initial höhere Biegefestigkeit haben. Sowohl im subtraktiven als auch im additiven Herstellungsverfahren existieren mittlerweile zusätzlich zu den konventionellen Materialien auch flexible Untergruppen. Diese weisen andere mechanische Eigenschaften auf und tragen somit auch zur Heterogenität bei, insbesondere bei den dreidimensional (3D) gedruckten Materialien. Flexible 3D-gedruckte Materialien weisen den höchsten Verschleiß im Vergleich zu konventionell und subtraktiv verarbeiteten Materialien auf. Konventionelle 3D-gedruckte Materialien haben eine ähnliche Abrasionsbeständigkeit wie konventionell und subtraktiv verarbeitete Materialien. Die Elution von Monomeren in Wasser ist bei 3D-gedruckten Schienen höher als bei konventionell oder subtraktiv hergestellten, wobei eine nachträgliche Oberflächenpolitur die Biokompatibilität verbessern kann. Zudem beeinflussen sowohl die 3D-Druckrichtung als auch die Nachbearbeitungsschritte wie Reinigen und Nachpolymerisieren das Ergebnis und können es durch eine Nachpolymerisation, beispielsweise unter Stickstoff, weiter verbessern. Schlussfolgerung: Um fundierte Aussagen über die klinische Eignung der 3D-gedruckten Schienen treffen zu können, sind weitere In-vitro- sowie In-vivo-Studien notwendig.
Schlagwörter: Schienen, Kieferorthopädie, 3D-Druck, CAD/CAM, mechanische Eigenschaften
Kieferorthopädie, 4/2024
Seiten: 325-331, Sprache: Deutsch, EnglischHoffmann, Lea / Wichelhaus, Andrea / Keller, AlexanderLeitpfad für das digital geplante indirekte BondingIm vorliegenden Artikel werden zwei Möglichkeiten zur digitalen Planung und Herstellung indirekter Übertragungsschienen beschrieben. Die digitale Entwicklung in der Kieferorthopädie ermöglicht heute neue Arbeitswege, insbesondere im Bereich des indirekten Bondings. Dabei kann man die semidigitale Methode, welche die digitale Bracketplanung mit der konventionellen Tiefziehmethode kombiniert, von der vollständig digitalen Methode unterscheiden, bei der die Übertragungsschienen 3-D-gedruckt werden. Beide Methoden weisen Vor- und Nachteile hinsichtlich der Genauigkeit der Bracketübertragung auf. Eine klare Arbeitsweise ist jedoch entscheidend, um die Vorteile dieser Technologien optimal nutzen zu können. Eine kontinuierliche Entwicklung und Anpassung, basierend auf individuellen Patientenbedürfnissen und den neuesten Erkenntnissen der wissenschaftlichen Literatur, ist notwendig, um die vielversprechenden Möglichkeiten weiterzuentwickeln.
Schlagwörter: 3-D-Druck, digitaler Workflow, digitale Kieferorthopädie, indirektes Kleben, IDB
QZ - Quintessenz Zahntechnik, 10/2023
ErfahrungsberichtSeiten: 934-939, Sprache: DeutschKeller, Alexander / Hoffmann, LeaVom Intraoralscan zur 3-D-gedruckten Dehnplatte: der volldigitale WorkflowZiel des Beitrags ist, einen Leitpfad des volldigitalen Workflows am Beispiel einer Dehnplatte zu zeigen sowie die Vor- und Nachteile zu verdeutlichen. Durch den digitalen Workflow können einige konventionelle Arbeitsschritte ausgelassen oder auf digitale Hilfen (3-D-Drucker) umverteilt werden. Er stellt den Anwender jedoch auch vor neue Herausforderungen, wie den Ersatz von konventionellen Halteelementen (Dreiecksklammer, Labialbogen) oder die transversale Dehnung bei einem starren Plattenkörper. Außerdem müssen die hohen Anschaffungskosten und der anfänglich hohe Zeitaufwand zum Erlernen der Softwareprogramme mit bedacht werden.
Schlagwörter: 3-D-Druck, digitaler Workflow, Kieferorthopädie, Dehnplatte
Kieferorthopädie, 1/2023
Digital OrthodonticsSeiten: 59-65, Sprache: DeutschHoffmann, Lea / Keller, AlexanderGefräste versus gedruckte RetentionsgeräteIm vorliegenden Artikel werden zwei Möglichkeiten zur digitalen Herstellung von abnehmbaren Retainern vorgestellt: additive versus subtraktive Konstruktionen. Zudem sollen deren bisher bekannte Vor- und Nachteile aufgezeigt werden. Die digitale Entwicklung im Fach Kieferorthopädie ermöglicht es, nahezu jede gewünschte Konstruktion der hier zur Diskussion stehenden herausnehmbaren Retentionsgeräte vorzulegen. Die Planung der individuell notwendigen Retentionsmaßnahmen erfolgt in Art und Umfang im Abgleich vom Ausgangs- zum Endbefund und in Relation zur durchgeführten kieferorthopädischen Therapie. Dabei gilt es prognostisch alle Retentionskriterien zu berücksichtigen, denen das Kauorgan durch den skelettalen wie dentalen Aging-Wandel fortlaufend unterworfen ist. Die Herstellung der Retentionsgeräte wird beim additiven (3-D-Druck) Verfahren durch die spröde Materialeigenschaft der handelsüblichen Materialien (beispielsweise Dental Clear LT) begrenzt. Eine gute Alternative bietet das subtraktive Verfahren (Fräsen). Derzeit werden vermehrt 3-D-Druckmaterialien auf dem dentalen Markt vorgestellt, welche möglicherweise bald den Materialeigenschaften des subtraktiven Verfahrens gleichkommen.
Manuskripteingang: 01.11.2022, Annahme: 11.11.2022
Schlagwörter: 3-D-Druck, digitaler Workflow, Kieferorthopädie, Retention, Retainer
Kieferorthopädie, 1/2022
Seiten: 55-60, Sprache: DeutschKeller, Alexander / Hoffmann, LeaVom Intraoralscan zur 3-D-gedruckten Dehnplatte: Der volldigitale WorkflowDie digitale Kieferorthopädie ermöglicht neue Wege in der Herstellung herausnehmbarer Apparaturen. Ziel des Artikels ist es, einen Leitpfad des voll digitalen Workflows am Beispiel einer Dehnplatte zu zeigen, sowie die Vor- und Nachteile zu verdeutlichen. Im Gegensatz zum konventionellen Workflow benötigt man beim digitalen Workflow eine mittels Intraoralscan generierte STL-Datei, auf deren Basis jegliche Apparaturen angefertigt werden können. Durch den digitalen Workflow können einige konventionelle Arbeitsschritte ausgelassen oder auf digitale Hilfen (3-D-Drucker) umverteilt werden. Jedoch stellt ein digitaler Workflow den Anwender auch vor neue Herausforderungen, wie den Ersatz von konventionellen Halteelementen (Dreiecksklammer, Labialbogen), oder die transversale Dehnung bei einem starren Plattenkörper. Dies ist nur durch Modifikationen der Dehnplatte im Sinne eines sogenannten „wrap around“ (Ummantelung) möglich, welcher durch dehnbare Gummiketten fixiert wird. Letztendlich lässt sich durch den digitalen Workflow eine individualisierte Apparatur bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis erreichen. Jedoch müssen die hohen Anschaffungskosten (Intraoralscanner, 3-D-Drucker, Reinigungsbad, Härteofen) und der anfänglich hohe Zeitaufwand zum Erlernen der Softwareprogramme dem gegenübergestellt werden.
Schlagwörter: 3-D-Druck, digitaler Workflow, Kieferorthopädie, Dehnplatte