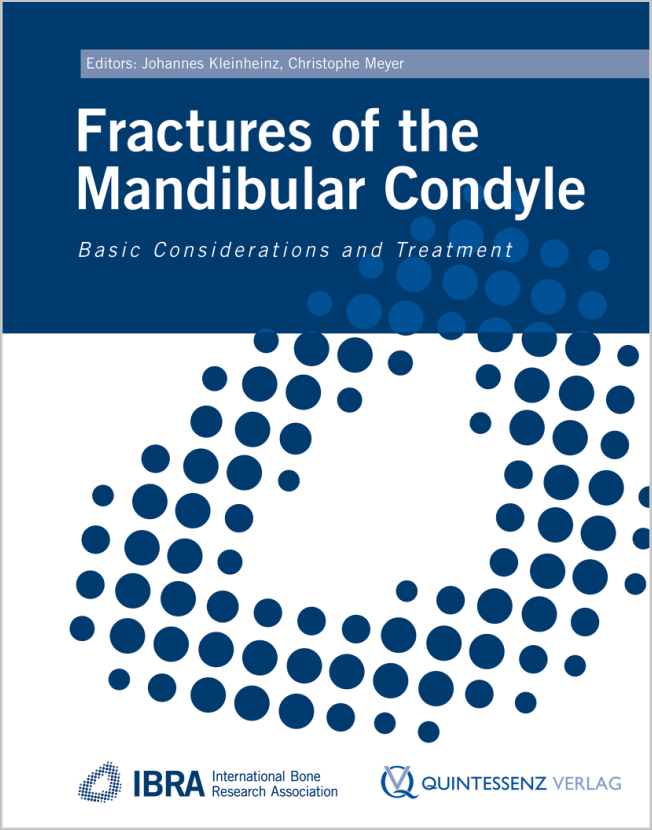International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 2/2025
Poster 2693, Sprache: Englisch, DeutschDaume, Linda / Jaber, Mona / Oelerich, Ole / Kleinheinz, JohannesDie Osteogenesis imperfecta (OI) ist eine seltene genetische Störung, die durch einen Defekt des Kollagens Typ I gekennzeichnet ist und zu Knochenbrüchigkeit und Bindegewebszerfall führt. Zu den orofazialen Manifestationen der OI gehören Dentinogenesis imperfecta (DI), Zahn- und Kieferfehlstellungen sowie Zahnanomalien.Dieser Fallbericht zeigt eine 4-jährigen Patientin mit OI zeigten sich bei der oralen Untersuchung für die DI typischen, braunen Verfärbungen an allen Milchzähnen. Die Zähne waren bereits stark abradiert und die Bisshöhe reduziert. Die Patientin war beschwerdefrei und führte eine optimierte Mundhygiene durch.Patienten mit diesen genetisch bedingten Strukturanomalien brauchen eine lebenslange, engmaschige, interdisziplinäre, zahnärztliche Betreuung zum Erhalt der Therapieergebnisse.
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 2/2025
Poster 2694, Sprache: Englisch, DeutschDaume, Linda / Kleinheinz, JohannesEine Patientin mit ektodermaler Dysplasie (ED) stellte sich mit insgesamt 20 Zahnnichtanalgen, einschließlich der Weisheitszähne, vor. Eine ED konnte durch eine molekulargenetische Untersuchung bestätigt werden. Ein implantatgetragener Zahnersatz zur festsitzenden, kaufunktionellen Rehabilitation wurde beantragt und als Ausnahmeindikation seitens der Krankenkasse genehmigt Die Behandlung erfolgte nach Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung im Alter von 17 Jahren. Somit kann bei Patienten mit multiplen Nichtanalgen bereits vor Abschluss des Wachstums eine implantatprothetische Versorgung erfolgen. Die Patienten gewinnen nachweislich an Lebensqualität.
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 2/2025
Poster 2695, Sprache: Englisch, DeutschDaume, Linda / Poggenpohl, Laura / Joanning, Theresa / Kleinheinz, JohannesLichen planus ist eine häufige, chronisch-entzündliche Erkrankung, welche die Haut und die Schleimhäute (besonders die orale und genitale Mukosa) befällt und deren Ätiologie nicht bekannt ist. Zur Therapie werden zunächst topische, kortikosteroidhaltige Salben, Gele oder Mundspülungen verwendet. Bei lokal begrenzten, chronisch ulzerativen oralen Lichen planus (OLP)-Läsionen kann eine intraläsionale Kortikosteroidapplikation erfolgen, die mitunter 2 bis 3 mal im Abstand von jeweils knapp einem Monat wiederholt werden kann. Der vorliegende Fallbericht zeigt, dass die intraläsionale Injektion von Triamcinolon eine wirkungsvolle Therapie für therapierefraktäre Fälle des OLP ist. Eine langfristige und regelmäßige Kontrolle muss erfolgen.
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 2/2025
Poster 2691, Sprache: Englisch, DeutschJaber, Mona / Kanemeier, Moritz / Stamm, Thomas / Schmid, Jonas Q. / Kleinheinz, JohannesZiel der vorliegenden Studie war die Einführung und Validierung eines offenen Workflows für die cephalometrische Auswertung aus digitaler Volumentomografie (DVT) generierten 2D Fernröntgenseitenbildern (FRS).Diese Studie wurde an 4 Patienten durchgeführt, bei denen zum gleichen Zeitpunkt ein FRS und DVT mit ausreichend großem FOV vorlagen. Mit Hilfe eines für dieses Projekt geschriebenen Phyton-Skripts wurden 2D FRS-Aufnahmen aus den DVTs rekonstruiert. Jedes Bild wurde von 6 Ratern cephalometrisch ausgewertet. Die Übereinstimmung der cephalometrischen Werte aus beiden Verfahren wurde mittels Bland-Altman Analyse überprüft.Mittels offenem Workflow war es in allen Fällen möglich eine für die cephalometrische Auswertung suffiziente 2D Rekonstruktion zu generieren. Die hiermit durchgeführten cephalometrischen Analysen führten zu klinisch vergleichbaren Ergebnissen.Der vorgestellte offene Workflow konnte am vorliegenden Patientenkollektiv validiert werden.
Schlagwörter: offener Workflow, cephalometrische Auswertung, Rekonstruktion FRS aus DVT, Bland-Altman Analyse
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2025
Poster 2669, Sprache: Englisch, DeutschKöckerling, Nils / Oelerich, Ole / Daume, Linda / Kleinheinz, JohannesDas Marcus-Gunn-Syndrom, oder die mandibulopalpebrale Synkinese, ist eine angeborene Mitbewegung des Oberlids beim Öffnen des Mundes. Ursache ist eine paradoxe ipsilaterale Innervation zwischen Lidheber und dem Musculus pterygoideus lateralis. Klinisch zeigt sich eine Ptosis des betroffenen Augenlides, die sich im Moment der Mundöffnung aufhebt. Das inverse Marcus-Gunn-Phänomen beschreibt einen ipsilateralen Lidschluss bei Kontraktion des Musculus pterygoideus lateralis. Die Kombination beider Phänomene wird auch als „See-Saw“ Marcus Gunn-Syndrom bezeichnet. Hier handelt es sich um einen angeborenen Zustand, der bei Mundöffnung einseitig zum Anheben des Oberlids und zum Absenken des Oberlids auf der Gegenseite führt. Dieser Zustand gilt als eine extreme Rarität. In diesem Fallbericht zeigen wir eine zwanzigjährige Frau, die von Geburt an erkrankt ist. In Ruhe zeigt sich eine unvollständige Ptosis des rechten Auges. Bei Mundöffnung hebt sich das rechte Lid unwillkürlich an und das linke obere Augenlid senkt sich fast vollständig. Darüber hinaus zeigt sie eine beidseitige unwillkürliche Pupillenbewegung nach links kaudal. Eine kausale Therapie ist bisher nicht bekannt, eine genetische Beratung wird empfohlen. Therapieansätze beziehen sich auf selbstständiges bewusstes Training des fehlinervierten Lides vor dem Spiegel, in schweren Fällen können operative Korrekturen erwogen werden.
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2025
Poster 2683, Sprache: Englisch, DeutschNafz, Ludwig / Trento, Guilherme / Lisson, Jacqueline / Jung, Susanne / Kleinheinz, JohannesReife zystische Teratome im Neugeborenenalter – eine Fallserie Das reife Teratom des Neugeborenen stellt im kraniofazialen Bereich eine sehr seltene, jedoch stark ästhetisch beeinträchtigende, funktionseinschränkende und potentiell lebensbedrohliche Entität dar, die nach der Graduierung nach Gonzalez-Crussi in 4 Grade (0-3), je nach prozentual unreifen Anteilen am Gesamttumor (0%, 50%), eingeteilt werden kann. Aufgrund der Seltenheit und Komplexität des Krankheitsbildes, sowie der Frage nach Abwägung von notwendiger Radikalität und potentieller Mutilation, stellen wir anhand einer Fallserie ein multidisziplinäres Konzept für den Umgang mit diesem Krankheitsbild vor. Die Fallreihe umfasst drei Patienten, bei denen innerhalb der Neonatalperiode eine extra- und intraoral sicht- und tastbare Neoplasie mit respiratorischer Insuffizienz festgestellt wurde, sodass eine stationäre, intensivmedizinische Betreuung,sowie eine akute operative Reduktion der Raumforderung notwendig wurde. Präoperativ erfolgte in allen Fällen, neben der Probengewinnung und histologischen Sicherung der Diagnose, eine MR-Untersuchung zur Planung des operativen Eingriffs. In allen Fällen konnte ein reifes Teratom, G0 nach Gonzalez-Crussi, nachgewiesen werden. Es erfolgte eine therapiebegleitende, wiederholte Vorstellung in der interdisziplinären pädiatrischen Tumorkonferenz. Die Resektionen erfolgten in Abstimmung mit den Therapieprotokollen der MAKEI V Studienzentrale für extrakranielle Teratome in Bonn. Nach der Resektion konnte in allen drei Fällen eine sofortige Funktionsverbesserung und ästhetische Korrektur erzielt werden, sodass regelrechte Atmung, orale Ernährung und eine zeitgerechte kindliche Entwicklung im häuslichen Umfeld ermöglicht wurde. Nach Studienprotokoll wurde auf mutilierende Eingriffe verzichtet, weshalb eine vollständige Resektion nicht angestrebt wurde. Alle Patienten befinden sich in multidisziplinärer, dem individuellen Risiko angepasster, Tumornachsorge.
Schlagwörter: Tumor, Teratom, Pädiatrie, Kopf-Hals
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2025
Poster 2670, Sprache: Englisch, DeutschNafz, Ludwig / Oelerich, Ole / Jaber, Mona / Kleinheinz, JohannesDas periphere, extraossäre Ameloblastom ist mit 1-2% der seltenste Subtyp der Ameloblastome. Wir berichten von einem Fall, bei dem ein peripheres Ameloblastom vom akanthomatösen Typ an derselben Lokalisation eines zuvor entfernten zentralen Ameloblastoms auftrat. Vor 15 Jahren wurde bei der Patientin ein zentrales Ameloblastom des rechten Kieferwinkels entfernt. Die Patientin befand sich in zunächst halbjährlicher, dann jährlicher klinischer und radiologischer Kontrolle, welche vor 8 Jahren beendet wurde. Aktuell stellte sich die Patientin auf Anraten ihres Hauszahnarztes erneut mit einer exophytisch wachsenden Schleimhautveränderung im Bereich des ehemaligen Resektionsgebietes vor. Es erfolgte die Probeentnahme und histologische Untersuchung, wobei ein peripheres Ameloblastom vom akanthomatösen Typ festgestellt werden konnte; von einer mikroskopisch vollständigen Entfernung konnte aufgrund randständiger Zellnester nicht ausgegangen werden. Aufgrund der Seltenheit des Befundes besteht kein eindeutiger Konsens bezüglich der nötigen Radikalität der Entfernung. In diesem Fall wurde auf eine Nachresektion zugunsten der engmaschigen, klinischen und radiologischen Verlaufskontrolle verzichtet; es wurde erneut ein halbjährliches Nachsorgeintervall festgelegt.
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2025
Poster 2685, Sprache: Englisch, DeutschNafz, Ludwig / Daume, Linda / van der Bijl, Nils / Kleinheinz, JohannesDas cornu cutaneum stellt einen klinischen Befund dar, welcher aufgrund einer Vielzahl verschiedener benigner und maligner Ätiologien entstehen kann. Die Probeentnahme mit anschließender histologischer Untersuchung gilt als Goldstandard der Diagnostik und ist in der Regel therapeutisch wegweisend. Wir berichten von einem Fall, bei dem sich ein Patient mit zwei cornua cutanea der Unterlippe in unserer Poliklinik vorstellte. Vor 5 Jahren wurde bereits eine Probeexzision alio loco durchgeführt, bei der histologisch ein gut differenziertes Plattenepithelkarzinom (G1), nicht in toto exzidiert, festgestellt werden konnte. Der Patient lehnte weitere operative Therapieempfehlungen der damals behandelnden Ärzte ab. Aufgrund des größenprogredienten und funktionell einschränkenden Befundes stellte sich der Patient in unserem Hause vor. Nach Abtragung der Läsionen erfolgte die histologische Untersuchung. Jetzt konnte, neben verrukös hyperplastischem Plattenepithel, kein Anhalt für Malignität festgestellt werden. Aufgrund der nun histologisch sicher ausgeschlossenen Malignität konnte der Patient mit einem ästhetisch und funktionell rehabilitierten Zustand in ein Nachsorgeprogramm mit halbjährlichen klinischen Kontrollen entlassen werden, um etwaige Rezidive frühzeitig zu erkennen und abzutragen.
Schlagwörter: Cornu cutaneum, Plattenepithelkarzinom, Gesicht, Unterlippe
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2025
Poster 2686, Sprache: Englisch, DeutschJaber, Mona / Trento, Guilherme / Daume, Linda / Hanisch, Marcel / Kleinheinz, JohannesBei der Primary failure of eruption handelt es sich um eine genetisch bedingte partielle Eruptionsstörung was zu einem offenen Seitenzahnbiss führt. Der klinische Schweregrad und die Ausprägung der PFE sind variabel. Die korrekte Diagnose dieser eruptiven Anomalie spielt eine wesentliche Rolle bei der Behandlungsplanung, die prothetisch, kieferorthopädisch, chirurgisch oder multidisziplinär sein kann. Das Ziel dieser Studie war es, inwieweit man von der radiologischen Darstellung der PFE im OPG, eine adäquate Therapie ableiten kann. Bei 42 Patienten mit einer gesicherten PFE wurden präoperative OPG Aufnahmen ausgewertet. Die Grundlagen der Therapieentscheidungen wurden wie folgt definiert: Evaluation der betroffenen Zähne, Evaluation des Knochens, Okklusionslinien im posterioren Bereich. Anhand von OPG Aufnahmen bei Patienten mit PFE lässt sich eine Therapie standardisieren. Folgende Therapieoptionen konnten wir von den OPG Aufnahmen ableiten: Wenn die Zähne etwas unterhalb der Okklusionsebene liegen, ist eine prothetische Behandlung angezeigt ; bei einer negativen Okklusionslinie im Unterkiefer und auch im Oberkiefer wäre die Extraktion / Augmentation / Implantation / Prothetik als Behandlungsoption zu wählen; bei im UK nach kaudal verlagerte Okklusionsebene und im Oberkiefer nach cranial verlagerte, wäre eine bimaxilläre Umstellungsosteotomie indiziert; bei einseitiger Verlagerung der Okklusionsebene im UK nach kaudal und im OK nach cranial wäre eine Distraktion indiziert oder eine Segment Osteotomie mit Fixation. Die Auswertung der OPG Aufnahmen von gesicherten PFE Patienten haben ergeben, dass man Kriterien festlegen kann, die zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Therapie führt.
Schlagwörter: Orthopantomogramm, OPG, Primary failure of eruption, PFE, Therapieoption, Therapieentscheidung, Therapie standardisieren
International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2025
Poster 2688, Sprache: Englisch, DeutschWerner, Julian / Köckerling, Nils / Kleinheinz, Johannes / Daume, LindaDie akute myeloische Leukämie (AML) stellt ein akutes Krankheitsbild dar, bei dem sich B-Symptomatiken wie Schwäche, Fieber, Nachtschweiß meist früh in der Anamnese zeigen. Unterformen der AML können hingegen mit spezifischen Symptomen, beispielsweise in Form von Gingivahyperplasien imponieren. Die Probeentnahme (PE) mit histologischer Untersuchung gilt als Goldstandard der Diagnostik. Wir berichten von einem Fall, bei dem sich eine Patientin mit Gingivahyperplasie Regio 17-13 im September 2023 vorstellte. Die durchgeführte PE erbrachte den V.a. ein Chlorom (syn. Myeloblastom oder granulozytäres Sarkom), welches die extramedulläre Manifestation der AML oder eines der AML verwandten Syndroms darstellt. Anschließend erfolgte die Überweisung in die onkologische Tagesklinik. Nach weitergehender Diagnostik konnte eine AML mit NPM1-Mutation nachgewiesen und die Patientin in die onkologische Therapie überführt werden. Eine vollständige Inspektion und Palpation der Mundhöhle ist zur Früherkennung von (malignen) Veränderungen unerlässlich. Zudem zeigen systemische Erkrankungen nicht selten orale Manifestationen als Erst- oder Begleitsymptom. Hier kann der Zahnarzt eine entscheidende Rolle in der raschen Feststellung der Diagnose spielen. Zeigen Läsionen innerhalb von zwei Wochen trotz adäquater Therapie keine Heilungstendenz, muss die zuvor gestellte (Verdachts-)Diagnose und auch der zytologische bzw. histologische Befund hinterfragt und dieser ggf. wiederholt werden.
Schlagwörter: Akute myeloische Leukämie, AML, Orale Manifestation